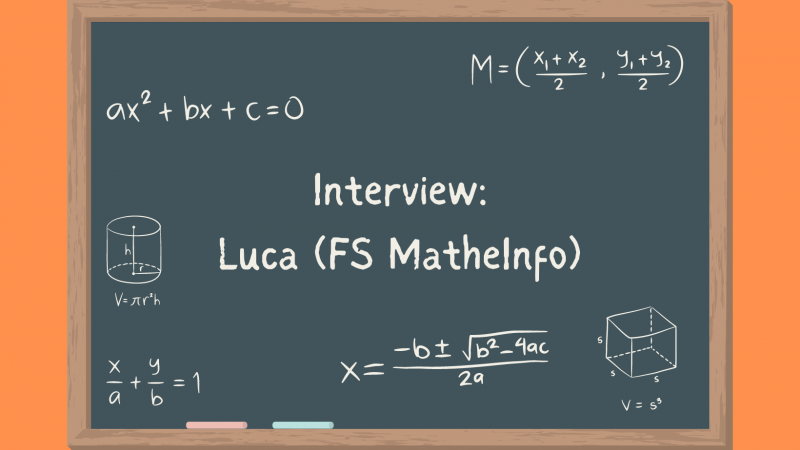Im Studium Frieden und Konflikte erforschen

FuK. So seltsam die Abkürzung, so bekannt ist sie in fast ganz Marburg. Kein Wunder, das Studium der Friedens- und Konfliktforschung ist hochbeliebt. Studierende aus allen Fachbereichen treffen in den angebotenen Exportmodulen für einen Bachelorstudiengang aufeinander und die Bewerberzahlen für den Master rangieren bei 35 Plätzen pro Jahrgang im mittleren dreistelligen Bereich. Nun feierte der Masterstudiengang FuK im letzten Semester sein zehnjähriges Bestehen. Im Wintersemester 2004/2005 nahm die Uni Marburg die ersten Master-Studierenden auf. PHILIPP sprach mit Professor Dr. Thorsten Bonacker, Leiter des Instituts, über die Aufgaben der FuK, die vergangenen zehn Jahre und was noch kommen soll.
PHILIPP: Fangen wir mal bei der Ursuppe an: Mit was beschäftigt sich denn eigentlich die Friedens- und Konfliktforschung (FuK)?
Prof. Dr. Thorsten Bonacker: Mit gewaltsamen oder zumindest gewaltträchtigen Konflikten zwischen Gruppen, Organisationen oder Staaten. Wenn man es negativ ausdrückt also weniger mit Konflikten auf der Mikroebene. Im Moment sind es im hohen Maße aber innergesellschaftliche Gewaltkonflikte, da die meisten Konflikte seit den 1990er Jahren innerstaatlich oder gesellschaftlich sind. Auch wenn es gerade seit jüngster Zeit auch wieder einige zwischenstaatliche gewalthafte Konflikte gibt. Neben der Analyse dieser Konflikte beschäftigt sich die FuK aber auch mit ihrer möglichst zivilen und damit gewaltlosen Bearbeitung.
Das klingt sehr spannend. Warum gibt es das Fach denn dann nur im Master hier in Marburg?
Prinzipiell gibt es schon Möglichkeiten FuK in Marburg auch jenseits der Masterstudiengänge zu studieren. So ist es im B.A. Sozialwissenschaften beispielsweise Teil des Pflichtprogramms, und auch in anderen Studiengängen ist es als Wahlpflichtmodul in den Bachelorstudiengang integriert. Ansonsten ist es so, dass die FuK von der Geschichte her ein sehr interdisziplinäres Forschungsgebiet ist. Deswegen setzt sie auch voraus, dass man eine bestimmte Disziplin auch kennengelernt hat. Ich denke, dass es deshalb sinnvoll ist, ein Hauptfach FuK auch erst auf der Ebene von Masterstudiengängen anzubieten, damit Studierende auch mit einer bestimmten disziplinären Perspektive in diesen Studiengang kommen. Das kann eine sozialwissenschaftliche, kulturwissenschaftliche, vielleicht aber auch historische oder psychologische Perspektive sein. Aber ich glaube, der Studiengang wie auch das ganze Forschungsgebiet lebt davon, dass viele Disziplinen zusammenkommen.
Das heißt die etwa 35 Studierenden eines Jahrgangs kommen aus allen verschiedenen Disziplinen hier her?
Genau. Ich würde sagen, ungefähr die Hälfte unserer Studierenden hat einen sozial- oder politikwissenschaftlichen Abschluss und ungefähr die Hälfte hat andere Abschlüsse, die von Jura und Psychologie über Soziale Arbeit und Pädagogik bis hin zu Kulturwissenschaften, Geschichte oder Wirtschaftswissenschaften reichen.
Am Ende sind es trotzdem nur 35 Studierende, die einen Studienplatz ergattern. Gibt es da ein bestimmtes Auswahlverfahren bezüglich der Studiengänge?
Der bereits studierte Studiengang ist nicht primär entscheidend und wichtig für uns. Wichtig in unserem Eignungsfeststellungsverfahren ist eher, wie sie ihren Studiengang und das was sie bis jetzt gemacht haben, dazu in Beziehung setzen, was sie jetzt studieren wollen und später damit machen möchten. Erfahrungsgemäß gibt es da viele Möglichkeiten. Ein Beispiel: Jemand hat Soziale Arbeit studiert. Man könnte jetzt sagen: Das ist aber sehr weit weg von einem Studiengang, der sehr stark auf der Makroebene angesiedelt ist. Aber wenn die Person deutlich macht, dass sie beispielsweise später im sozialpädagogischen Bereich in NGOs arbeiten möchte, dann macht die Wahl eines Studienganges, der sich mit Konfliktbearbeitung beschäftigt, natürlich viel Sinn. Weil es in konfliktbehafteten Gebieten natürlich auch darum geht, wie man mit Menschen umgeht oder ihnen in schwierigen Lagen zur Seite stehen kann. Umgekehrt hat nicht jeder, der Politikwissenschaft studiert hat, eine realistische und klare Vorstellung, wieso er FuK studieren möchte.
Wo arbeiten denn die meisten der FuK-Alumni?
Wie es für sozialwissenschaftliche Studiengänge typisch ist, sind auch die Tätigkeitsfelder nach dem Studium der FuK breit gefächert. Man kann aber sagen: Viele unserer Studierenden arbeiten in internationalen NGOs, der Entwicklungszusammenarbeit oder der politischen Bildung. Einige sind auch in der Wissenschaft geblieben, wobei das in der FUK eher ein kleiner Teil ist, da die meisten unserer Studierenden von Anfang an die Berufspraxis außerhalb der Wissenschaft anstreben.
In Deutschland sind die FuK-Professuren sehr begrenzt. Was zeichnet Marburg gegenüber Hamburg, Tübingen, Frankfurt und Magdeburg aus?
Alle Studiengänge haben sehr eigene Profile und die Studierenden bewerben sich natürlich auch an mehreren Orten. Wir bekommen 400 Bewerbungen auf 35 Plätze. Bei den anderen Studiengängen ist die Relation ähnlich. Der Marburger Studiengang zeichnet sich in meinen Augen aber erstens dadurch aus, dass er der einzige ist, der ein internationales Praktikum beinhaltet und das finden Studierende – obwohl es verpflichtend ist – eigentlich ganz spannend und liegt in ihren Interessen. Zweitens ist er sehr offen dafür, was die Studierenden vorher studiert haben. Die meisten anderen Studiengänge haben einen hohen Anteil von Politikwissenschaft als Voraussetzung. Drittens ist unser Studiengang in Marburg, obwohl wir auch einen hohen Forschungsanteil haben, sehr praxisorientiert indem wir Lehrveranstaltungen anbieten, die sich mit beispielsweise Mediation oder Projektmanagement beschäftigen, oder Menschen aus der Berufspraxis in unsere Lehrveranstaltungen einbeziehen. Damit einher geht auch ein spezifischer didaktischer Anspruch, da wir viel in Kleingruppen, mit Plan- und Rollenspielen oder Exkursionen arbeiten.
Wie äußert sich diese besondere Art der Didaktik denn unter den Studierenden?
Die Studierenden erleben bei uns sehr großen Zusammenhalt. Das gesamte erste Semester studieren sie beispielsweise als Gruppe. Fast wie im Klassenraum. Das kennt man als Studentin oder Student ja fast gar nicht mehr, weil sich nach der Einführungsveranstaltung sonst ja meistens alles zerläuft. Im ersten Jahr entwickelt sich unter den Studierenden ein großer Zusammenhalt, was viele unserer Studierende sehr schätzen. Das kann zwar auch mal zu Konflikten führen, aber da gibt es ja Mittel und Wege, wie man damit umgehen kann.
Vor allem wenn man vom Fach ist. Außerhalb dieser Gruppe hat man doch aber auch Kontakt zu anderen Studierenden, oder?
Ja. In rund einem Drittel der Lehrveranstaltungen sind die Studierenden des Studiengangs unter sich. In den anderen zwei Drittel des Studiums sitzt man aber sehr wohl mit anderen Masterstudierenden zusammen, entweder weil unsere Module für andere offen ist, oder unsere Studierenden selbst ein so genanntes Importmodul aus einem anderen Studiengang studieren. Und das ist auch gut so.
A propos, Bachelor- und Mastersystem. Ziehen Sie doch jetzt mal nach zehn Jahren FuK-Master eine Bilanz für uns. Sieht die gut oder schlecht aus?
Sehr gut eigentlich. Ich würde behaupten: Friedens- und Konfliktforschung als Hauptfach würde es in Deutschland ohne die Umstellung auf das Bachelor- und Mastersystem gar nicht geben. Denn was wir ja ganz oft vergessen: Es ist nicht nur eine Veränderung in der Organisation von Studium und Lehre, sondern auch der politischen Rahmenbedingungen. In Diplom- und Magisterzeiten sind Studiengänge vom Ministerium genehmigt worden. Da hat nicht die Universität Studiengänge eingerichtet, sondern sie hat einen Antrag gestellt, für welches das Ministerium positiv entscheiden musste. Das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst war in den 1990er-Jahren beispielsweise äußerst skeptisch, ein Nebenfach „Friedens- und Konfliktforschung“ einzurichten. 1996 konnte das nur mit großem Überzeugungsaufwand am Ende erreicht werden. Ein Hauptfach hätte es aber nicht gegeben. Das ging erst mit der Selbststeuerung der Universität, die jetzt selbst entscheiden kann, welche Schwerpunkte sie setzen will. Außerdem glaube ich, dass das Bachelor/Master-System für die FuK besonders interessant ist, weil man sich so interdisziplinär organisieren und Inhalte aus anderen Studiengänge – wie bei uns etwa der Psychologe und Rechtswissenschaften – ins Pflichtcurriculum integrieren kann.
Die starke Kritik am Bachelor- und Mastersystem teilen Sie also nicht?
Nein. Ich glaube wir haben sehr viele interessante Möglichkeiten Studiengänge zu machen. Ob wir die nutzen oder die Studiengänge, die es bislang gibt, gut gemacht sind, ist natürlich eine andere Frage. Aber das liegt nicht am System, sondern an denjenigen, die sie machen.
Sind Sie und, soweit sie das sagen können, die Studierenden mit der Situation Ihres Studienganges an der Uni Marburg denn zufrieden?
Unsere Studierenden wünschen sich beispielsweise mehr Veranstaltungen zur Friedenspädagogik, was vor allem für diejenigen auch interessant ist, die aus der Pädagogik kommen oder in die Erwachsenenbildung gehen möchten. Außerdem würde ich mir mehr Geld für Exkursionen wünschen, die wir gerne mit unseren Studierenden machen. Die Mittel der Universität, die es dafür gibt, sind sehr begrenzt. Außerdem könnte ich natürlich auch sagen, es wäre schön, wenn wir mehr Lehrkräfte hätten, aber das würde wohl jeder sagen. Eigentlich bin ich ziemlich zufrieden, weil ich bei der Universitätsleitung und dem Fachbereich sehr viel Rückhalt für den Studiengang verspüre. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass er ein Erfolgsmodell ist: Wir waren der erste Masterstudiengang in Marburg, in den Aufbaujahren drittmittelgefördert durch die Deutsche Stiftung Friedensforschung und haben uns auch an der Entwicklung von Masterstudiengängen an der Universität intensiv beteiligt. Der Studiengang entwickelte auch für das 2001 gegründete Zentrum für Konfliktforschung eine große Schubkraft. Damals gab es eine studentische Hilfskraft, das war der einzige Mitarbeiter. Heute haben wir zwei volle Professuren und eine weitere, die zur Hälfte am Zentrum angesiedelt ist. Außerdem arbeiten mehrere wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Zentrum, an den Professuren und in Drittmittelprojekten. Nicht zuletzt in einer für die in der Vergangenheit für die Universität Marburg finanziell schwierigen Situation zeigt diese Weiterentwicklung doch, welchen Stellenwert wir hier besitzen. Und das finde ich sehr schön.
Wir haben jetzt viel über das inneruniversitäre Ansehen gesprochen, aber wie sieht es denn mit den außeruniversitären Ansehen aus? Wir haben inzwischen einige Berichte gesehen von Friedensforscher*innen, die Politiker*innen quasi sagen, warum fragt ihr uns nicht vorher?
Ich würde nicht sagen, dass wir nicht gefragt werden. Viele der Kolleginnen und Kollegen sind in der Politikberatung aktiv und besprechen auch mit Entscheidungsträgerinnen und –trägern aktuelle Konfliktlagen. Ich bin beispielsweise Mitglied in einer Arbeitsgruppe für Friedens- und Konfliktforschung im Auswärtigen Amt. Auf unserer Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung (AFK), das ist sozusagen unser Wissenschaftlerverband, in dessen Vorstand ich bin, hielt in diesem Frühjahr Außenminister Steinmeier die Eröffnungsrede. Ob das dann die gewünschten Effekte hat, das ist dann eine ganz andere Frage. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Forschungsergebnisse und politische Entscheidungsprozesse zwei unterschiedliche Dinge sind. Ich kann beispielsweise sagen, dass wir aus der Forschung wissen, dass Waffenlieferungen in der Regel Konflikte anheizen. Der Zusammenhang dürfte ähnlich stark sein wie der zwischen Rauchen und Lungenkrebs. Trotzdem gibt es Zigaretten und trotzdem gibt es Waffenlieferungen. Es gibt politische Logiken und Interessen, die sich offensichtlich nicht an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren. Das muss man so hinnehmen. Ich bin deswegen eher skeptisch und zurückhaltend, was Politikberatung angeht. Ich glaube, dass man da nicht zu viel Hoffnung haben sollte, da Politiker und Politikerinnen eben nach eigenen Gesetzen handeln und sich zwar beraten lassen, aber manchmal auch nur so beraten lassen, wie sie es gerne hätten. Zugleich ist die Friedens- und Konfliktforschung auch sehr präsent, in der Politik und in den Medien. Sehen Sie sich etwa das Friedensgutachten an, das von führenden deutschen Friedensforschungsinstituten jedes Jahr herausgegeben wird. Oder das schwedische Friedens-Forschungsinstitut SIPRI [Stockholm International Peace Research Institute], das mit seinen ebenfalls jährlich publiziertenWaffenlieferung-Statistiken viel Aufmerksamkeit erhält.
Und wie sieht das mit der medialen Berichterstattung aus? Sind Sie da der Meinung, dass der Journalismus ordentlich genug arbeitet oder könnte dieser sich mehr mit der Wissenschaft beschäftigen? Weil Medienerzeugnisse ja auch politische Prozesse beeinflussen.
Es gibt natürlich einfach gute und schlechte Journalisten und Journalistinnen. Heute ist ja der Tod eines Journalisten bekannt geworden, von dem ich sagen würde, er war wahrscheinlich einer der besten der Bundesrepublik: Klaus Bednarz. Auch gerade in Bezug auf Konflikte, steht er für mich für Qualitätsjournalismus. In der Friedens- und Konfliktforschung gibt es eine Debatte darüber, ob wir nicht mehr Friedensjournalismus brauchen. Also ob wir nicht mehr Journalistinnen und Journalisten brauchen, die nicht nur über Gewalt und Konflikte reden, sondern auch über erfolgreiche Bearbeitung, Beilegung von Konflikten; also nicht immer auf die High-Politics blicken – wo die nächste Rakete fliegt, wo die nächsten Waffen geliefert werden, wo die nächsten Staatsmänner oder -frauen sich treffen, sondern stärker darüber berichten, wo es gelingt, Konflikte erfolgreich zu deeskalieren. Das ist sicherlich richtig. Zugleich bleibt es natürlich eine sehr wichtige Aufgabe, Hintergrundrecherche zu Konflikten und ihren Ursachen zu betreiben, Zusammenhänge aufzuzeigen und etwa Kriegsverbrechen auch beim Namen zu nennen. Aber vielleicht braucht man ein ausgewogeneres Verhältnis und auch Meldungen dazu, dass und warum ein Konflikt eben nicht eskaliert ist. Ich mach mal ein plakatives Beispiel: Wir berichten in den Sportnachrichten über Fußballspiele, bei denen Gewalt stattfindet. Dortmund-Schalke und die Hooligans gehen aufeinander los, das ist natürlich zwei Tage in der Presse. Es gibt in Schottland aber zum Beispiel ein Derby zwischen den zwei städtischen Fußballclubs von Dundee: Dundee United und FC Dundee, das regelmäßig in einer gemeinsamen Party endet und nicht in Massenschlägereien. Darüber wird dann aber weniger berichtet.
Nochmal zurück zum Studiengang: Wir kennen Leute, die FuK im Bachelor wegen der guten Noten studieren. Wissen Sie das und was denken Sie darüber?
Also ich unterrichte selbst ja nicht im Bachelor, deshalb kann ich selbst nicht viel darüber sagen. Aber man kann das ja aus zwei Seiten sehen: Man könnte entweder sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen sehr freundlich sind und gute Noten geben, oder man könnte sagen, dass Friedens- und Konfliktforschung überwiegend von den besseren Studierenden gewählt wird. Für den Masterstudiengang würde ich definitiv sagen, dass unsere Studierenden sicherlich zu den besten Studierenden an unserem Fachbereich gehören. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich den Studiengang leite und wir hier eine tolle Ausbildung machen, sondern es ist statistisch einfach wahrscheinlich, dass, wenn sie von 400 Bewerbungen auf 30 Studierende kommen, diese dann besser sind, als wenn sie alle Bewerbungen annehmen, um die Studienplätze besetzen zu können. Dazu kommt noch, dass Marburg sicherlich eine sehr reizvolle Stadt ist, aber wir gerade im Masterbereich schon Probleme haben, Studierende von außerhalb nach Marburg holen. Gegen diesen Trend kommen im Master fast alle Bewerbungen von außerhalb. Das heißt, es sind Studierende, die sich sehr genau überlegen, was sie wollen, wo sie hinwollen und dann bewerben sie sich hier. Und ich glaube, das ist ein besonderer Typus von Studenten und Studentinnen, den wir dann hier haben, und ich gehe davon aus, dass sich das auch positiv in der Note niederschlägt.
Wie sieht das Verhältnis zwischen Männern und Frauen aus? Weil eigentlich ist ja internationale Politik etwas sehr männlich konnotiertes, aber die Geisteswissenschaften haben ja immer mehr Zulauf von Frauen…
Und das gilt insbesondere für interdisziplinäre Studiengänge. In der Kombination – wir haben einen interdisziplinären Studiengang, es ist eben nicht internationale Politik, sondern Friedens- und Konfliktforschung, ein bisschen weicher, wenn sie so wollen – kann es auch nicht überraschen, dass knapp ¾ unserer Studierenden Frauen sind. Für die Neuankommenden stellt sich angesichts dieser Relation immer ein gewisser Schock ein, wenn sie in der OE sitzen.
Was wünschen Sie Sich für die Zukunft? So für die nächsten zehn Jahre für die FuK in Marburg?
Mehr außereuropäische Studierende, die mit einem Stipendium vielleicht hierher kämen. Das wär für mich ein großes Ziel. Wir haben jetzt einen ebenfalls sehr erfolgreichen und stark nachgefragten internationalen Masterstudiengang, den wir zusammen mit der University of Kent in Canterbury in Großbritannien anbieten, also auch ein Master für FuK, aber eben als double-degree Studiengang, demnächst als joint-degree-Studiengang. Für ein Jahr, das die Studierenden in England studieren, müssen aber Studiengebühren gezahlt werden, die gerade für Studierende aus Krisenregionen schwer aufzubringen sind. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass wir eine Möglichkeit hätten, dass wir für Studierende – gerade auch aus Konfliktregionen – hier eine Möglichkeit eröffnen könnten, ein Studium in Marburg aufzunehmen. Auf Englisch, weil die meisten kein Deutsch können und mit einem Vollstipendium, um die Lebenshaltungskosten zu bezahlen. Das hätte ich gerne.
FOTO: Cayusa auf flickr.com, CC-Lizenz
PHILIPP-Gründerin und Chefredakteurin von 2014 - 2017.