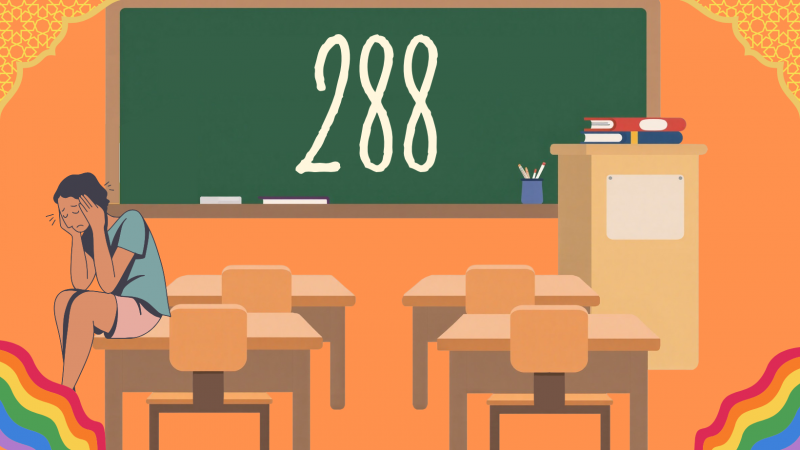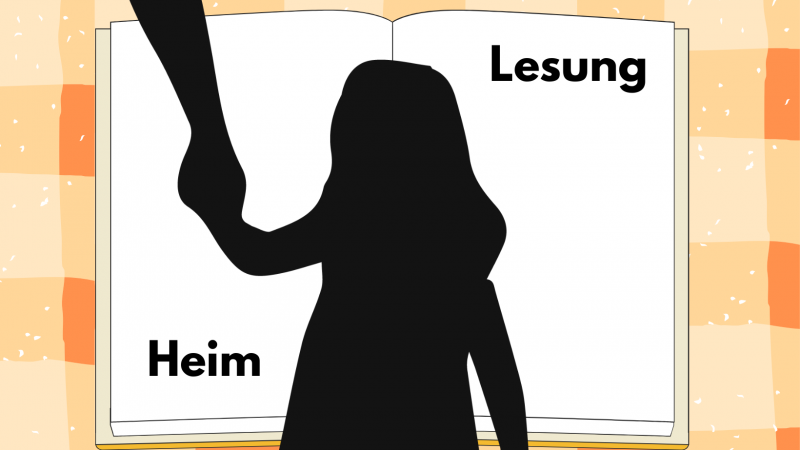„Natürlich habe ich Hoffnung“ – Lesung mit Martyna Linartas

Bild: Jannik Pflur
„… Denn ohne Hoffnung macht das doch alles keinen Spaß.“ Die Stimmung am Abend der Lesung aus Martyna Linartas neuem Buch Unverdiente Ungleichheit (erschienen bei Rowohlt, erhältlich für 24 Euro) lässt sich mit diesem Zitat der Autorin sehr gut beschreiben. Die Frage nach Hoffnungslosigkeit ist bei dem Thema des Buchs überhaupt nicht überraschend. Wie der Titel schon vermuten lässt, beschreibt die Autorin in ihrem neuen Bestseller die Vermögenssituation in Deutschland und wie diese noch fundamentaler ist, als man es sich vorstellet.
Unverdiente Ungleichheit beschönigt nicht, gibt klare, gut belegte, wenn auch Bauchschmerzen verursachende Fakten, um jede zukünftige Diskussion zum Thema Vermögensteuer dominieren zu können. Neben all den Problemen bietet es auch Lösungsansätze: Die konkrete Um- und vor allem Rückverteilung mit System, und eine realistische, aber starke Anpassung des Erbschaftsteuergestzes.
Linartas, eine promovierte Politikwissenschaftlerin, die unter anderem für den Spiegel und Zeit Online schreibt und als eine der profiliertesten Stimmen zur deutschen Vermögensverteilung gilt, tritt bei der Lesung leidenschaftlich und eindringlich auf. Ihre ruhige, aber bestimmte Art, komplexe Zusammenhänge verständlich zu erklären, macht den Abend nicht nur informativ, sondern auch emotional eindrücklich.
Gleich zu Beginn lässt Linartas die Menschen im Saal ein paar Fakten und konkrete Zahlen raten und schnell wird klar: Niemand ist auch nur annähernd am richtigen Ergebnis. Die Dimensionen der Ungleichheit sind selbst denjenigen, die sich für dieses Thema interessieren, offensichtlich nicht klar. Und genau deswegen ist dieses Buch so wichtig.
Tausende Meter über der Mitte der Gesellschaft
Sie gibt den Zuhörer*innen außerdem ein Gedankenspiel: Wir stellen uns ein DIN-A4-Blatt vor, hochkant, und teilen es in Zentimeter ein. Jeder einzelne steht für 50.000 Euro, das ganze Blatt entspricht dann etwa 1,5 Millionen Euro. Die Menschen sollen sich nun auf diesem Blatt mit ihrem Vermögen einordnen. Auf Nachfrage der Autorin stellt sich heraus: Niemand im Saal verlässt gedanklich dieses Blatt. Und auf die darauffolgende Frage, wie weit über dem Blatt sich denn die reichsten Menschen in Deutschland befinden, kamen Antworten zwischen 10 und 100 Metern. Die tatsächliche Antwort liegt bei 10.000 Metern, was der Höhe entspricht, auf der Flugzeuge fliegen. Der bereits ruhige Saal verstummt merklich.
Zwei deutsche Männer besitzen so viel Geld wie die untere Hälfte unserer Bevölkerung. Wie es zu so etwas kommen konnte, erklärt das Buch vor allem mit dem deutschen Erbschaftsteuergesetz. Leicht veranschaulicht, aber deswegen nicht weniger schwer verdaulich, stellt Linartas die Entwicklung besagten Gesetzes seit 1920 vor und macht sehr deutlich, wie ein lasches Erbschaftsteuergesetz Vermögenskonzentration massiv begünstigt und Schenkungen aktiv unterstützt.
Die Autorin untermauert viele ihrer Ausführungen mit kleinen Anekdoten und erzählt beispielsweise, wie die Springerverlag-Erbin Friede Springer dem Vorstandsvorsitzenden Mathias Döpfner große Anteile ihrer Aktien im Wert von einer Milliarde Euro geschenkt hat – und dies dank eines Schlupflochs nahezu steuerfrei.
Was Reichtum wirklich kostet
Im Rahmen der Ungleichheit spricht Linartas aber nicht nur über finanzielle Ungleichheit, sondern auch über die daraus resultierende Klima- und Chancenungleichheit: „Je größer das Privatvermögen, desto höher der CO₂-Ausstoß.“ 50 Prozent der Weltbevölkerung verbrauchen 1,4 Tonnen CO₂, wohingegen das reichste Prozent fast das 100-fache verbraucht. Einfach mal so.
Wer an diesem Abend dabei war, wird den Saal mit vielen wichtigen Antworten verlassen haben. Antworten, die sich allerdings nur selten gut anfühlen. Doch genau darin liegt die Kraft von Linartas Werk: Es konfrontiert einen, ohne zu lähmen. Stattdessen ermutigt die Autorin ihr Publikum, auf eine Weise selbst aktiv zu werden, die zum eigenen Leben passt. Für die einen bedeutet das, informiert zu bleiben und Diskussionen zu führen, für andere, auf die Straße zu gehen oder politisch zu handeln. Jede dieser Formen sei nicht nur legitim, sondern notwendig. Denn Veränderung beginnt dort, wo Ungleichheit nicht mehr hingenommen wird.
Psychologiestudentin mit Vorliebe für Politik und Gesellschaft, interessiert an jeder Perspektive.
24 Jahre alt und seit 2025 bei Philipp.