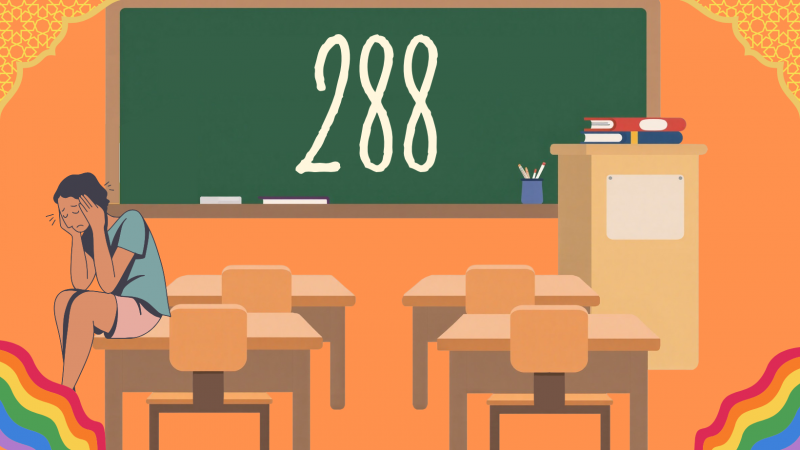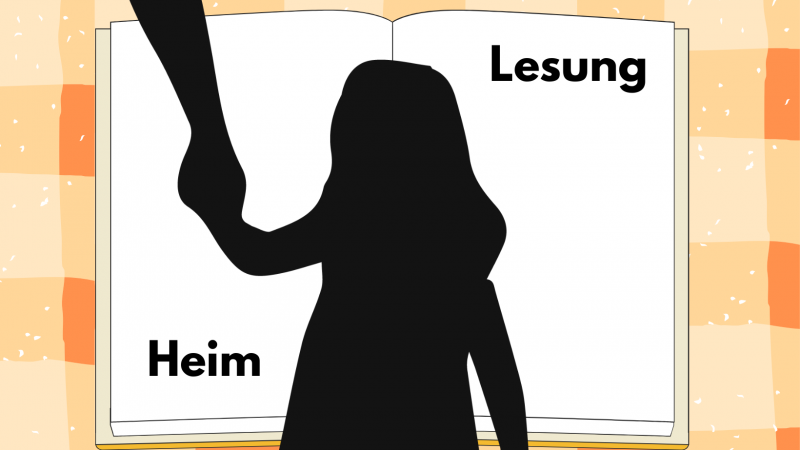„Dass Ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält“ – Ein Plädoyer für Goethes Faust
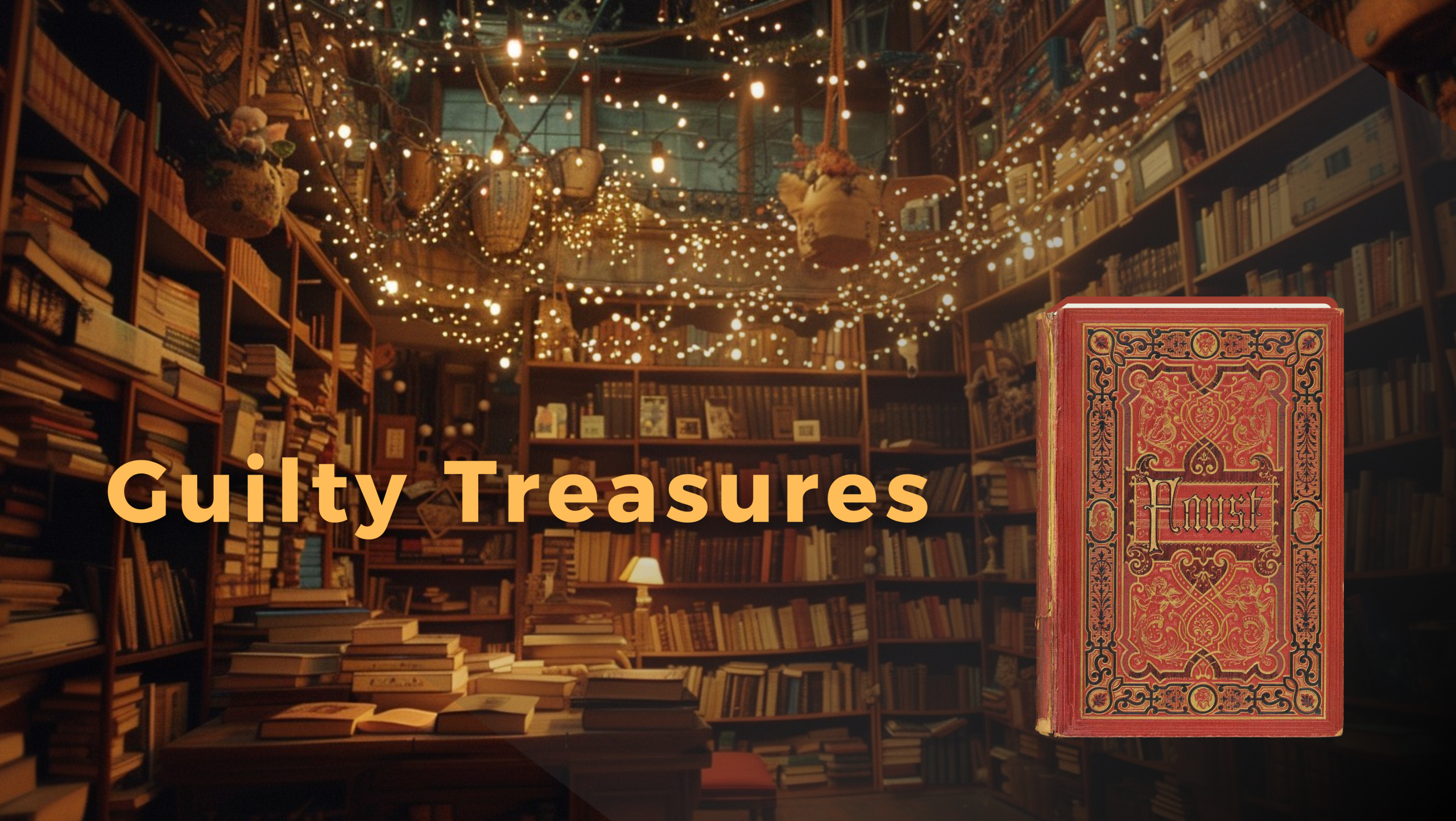
Bild: Laura Schiller
Es ist nie zu spät, sich kulturell weiterzubilden. Gerade die Studienjahre bieten endlose Zeit, unermüdliches Interesse, ja sogar akademische Pflicht, sich mit den künstlerischen Einträgen aus jedweder Epoche auseinanderzusetzen. In dieser Reihe möchten wir euch die wichtigsten Werke der Weltliteratur, die anerkanntesten Alben der Musikgeschichte und die fantastischsten Filmklassiker näherbringen – unserer Meinung nach, versteht sich.
Wie verliebt man sich in eine Tragödie?
Auf meinem Abiball durfte ich eine Rede halten. Zuvor hat meine Deutschlehrerin in ihrer Laudatio beschrieben, dass ich den ganzen Faust auswendig zitieren könne. Was sie nicht erwähnte: Dass sie meine Begeisterung für diese Schullektüre mehr als einmal vor dem ganzen Kurs ins Lächerliche gezogen hatte.
In meiner Rede: Faust-Zitate. Warum? Nicht (nur) als Seitenhieb gegen meine Lehrerin, sondern weil für mich alles schöner klingt, wenn es Goethe schreibt. „Du kannst alles schaffen“ wird zu „Sobald du dir vertraust, sobald weißt du zu leben“. Goethe schreibt nicht: „Probiere dich aus und hab Spaß“. Er schreibt: „Stürzen wir uns in das Rauschen der Zeit.“
Vielleicht hat meine Begeisterung irgendwann skurrile Züge angenommen. Ich war in zwei Faust Inszenierungen, besitze Salz- und Pfeffer-Streuer in der Form von Goethe und Schillers Köpfen, Goethe-Radiergummis und einen Playmobil-Goethe. Faust war nie nur Schullektüre für mich, es ist ein Stück, das sich tief in meiner Gedankenwelt verankert hat – Ausdruck meiner Liebe für klassische Literatur. Irgendwie komme ich immer wieder mit diesem Werk in Berührung. Und nicht nur ich scheine dieses Werk zu meiner Identität gemacht zu haben. Auch viele Menschen in meinem Umfeld verbinden diese Tragödie mit mir.
„Zwei Seelen wohnen ach! In meiner Brust.“
Der Gelehrte Heinrich Faust steht am Tiefpunkt seiner Existenz: Trotz all seines Wissens fühlt er sich unbefriedigt und vom Leben entfremdet. In dieser existenziellen Krise schließt er einen Pakt mit Mephisto, einem Teufel: Sollte dieser es schaffen, ihm einen Moment vollkommener Befriedigung zu schenken, gehört Fausts Seele ihm. Mephisto hat im Prolog im Himmel eine Wette mit Gott abgeschlossen. Dieser glaubt an die Vernunft des Menschen und erlaubt Mephisto, dies an Faust zu testen. Voller neuer Lebensgier stürzt sich Faust in das Diesseits – und begegnet Margarete, genannt Gretchen. Die Beziehung wird zur Katastrophe.
„Bin ich doch noch so jung, so jung und soll schon sterben?“
Es gibt viele Momente in der Literaturgeschichte, die mich tief bewegt haben. Der stille, erschütternde Augenblick, in dem Königin Elisabeth erkennt, dass das politische System sie zur Hinrichtung Maria Stuarts getrieben hat. Oder an Claire Zachanassians Rache in Dürrenmatts Der Besuch der alten Dame, die sich jahrzehntelang aufgestaut hat und nun langsam entfaltet. Aber kein Moment hat mich so gefesselt, wie die Kerker-Szene in Goethes Faust I, in der die Gretchen-Tragödie ihren Höhepunkt findet.
Margarete ist im Kerker dem Wahnsinn verfallen. Während Faust und Mephisto sich auf der Walpurgisnacht vergnügen, hat Margarete, von ihrem Geliebten verlassen und gesellschaftlich geächtet, ihr Kind in einem Weiher ertränkt.
Ein 50-jähriger Mann unter dem Einfluss eines Liebestranks, der ihn künstlich verjüngt, verführt ein 14-jähriges Mädchen. Es ist keine Liebesgeschichte. Faust dominiert Margarete emotional wie sexuell, stürzt sie wissentlich ins Unglück, um seine eigenen Triebe zu befriedigen. Er tötet ihren Bruder und indirekt auch ihre Mutter. Im Kerker scheint Margarete Fausts wahre Persönlichkeit jedoch endlich zu durchschauen. Sätze wie: „Warum wird mir an deinem Hals so bang, wenn sonst von deinen Worten, deinen Blicken ein ganzer Himmel mich Überdrang“ jagen mir jedes Mal einen Schauer über den Rücken. Ich liebe diese Sprache. Die Reimform, der Rhythmus, mit denen selbst das Grausamste noch eine gewisse Schönheit bekommt. Das fasziniert mich. Schönheit und Schrecken zugleich. Und dann spricht Margarete die Worte, die wir Leser*innen eigentlich schon lange empfinden: „Heinrich! Mir graut‘s vor dir!“. Während Mephisto sie verloren glaubt, kommt es zur Wendung: „Sie ist gerettet“, heißt es am Ende von den göttlichen Mächten. Margarete wird erlöst – Faust entflieht mit Mephisto. Und wir bleiben zurück. Mit lauter offenen Fragen.
„Da steh ich nun ich armer Thor und bin so klug als wie zuvor.“
Ich kann verstehen, wenn man sagt: Das ist alles zu schwer zu ertragen. Und es sind Szenen, wie diese, die den Faust für mich zu einem „Guilty Treasure“ machen. Denn obwohl Themen wie Machtmissbrauch und moralischer Verfall bedrückend aktuell sind, frage ich mich manchmal: Darf man an einem Werk so viel Freude haben? Aber gerade diese Widersprüche machen den Faust zu einem Werk der Moderne. Was mich am meisten fasziniert, ist die Ambivalenz, die in den Figuren steckt – und die man beim Lesen ständig selbst erfährt. Kaum beginnt man, Sympathie zu empfinden, macht der nächste Satz wieder alles zunichte. Auch Margarete – so grausam ihr Schicksal auch ist – ist keine reine Unschuldige. Sie wird zur Mitgestalterin ihres eigenen Untergangs. Das ist zwar schmerzhaft, macht das Drama aber auch komplex und authentisch. Bezeichnend: Ausgerechnet der Teufel erscheint als sympathischste Figur. Mit scharfem Witz, sarkastischem Charme und fast schon mitfühlendem Blick auf das Elend der Menschen erscheint Mephisto überraschend menschlich – oft menschlicher als Faust selbst. Vielleicht ist das die bitterste Pointe, aber auch der Grund, weshalb ich dieses Werk so liebe. Weil vielschichtig erzählt wird. Und dass Goethe mit Mephisto eine der intelligentesten Figuren der Weltliteratur geschaffen hat – samt schonungsloser Gesellschaftskritik.
„Es irrt der Mensch, solang er strebt“
„Leben“ heißt rückwärts geschrieben „Nebel“. Das beschreibt für mich das Grundgefühl des Faust. Die Suche nach Sinn. Faust ist mehr als ein literarisches Phänomen – er verkörpert in seiner Zerrissenheit die Grundfragen der Moderne. Ein Mensch, der nicht mehr eingebunden ist in Religion oder Familie, der strebt, um sich zu begreifen – und sich dabei selbst verliert. Es ist die Kritik am ewig schaffenden Menschen. An einem, der so sehr nach Erkenntnis und Aufstieg hungert, um ein titanischer Übermensch zu werden, dass er einen Pakt mit dem Bösen eingeht und dabei selbst Böses tut. Faust I ist Kritik an Religion, an gesellschaftlichen Zwängen und an übertriebenem Machtstreben. Goethe selbst hat die Arbeit am Faust-Stoff – vom Urfaust bis zu der Tragödie zweiter Teil – 60 Jahre seines Lebens begleitet. Es gibt mittlerweile unzählige Bearbeitungen: Opern, Filme oder moderne Romane wie Klaus Manns Mephisto. Diese Vielfalt zeigt, wie lebendig der Stoff bis heute geblieben ist.
„Das also war des Pudels Kern!“
Ich konnte mich nicht für einen Titel für diesen Artikel entscheiden. In meinen Notizen findet sich eine Liste mit 75 Lieblingszitaten aus Faust I. Und ungefähr genauso lang ist die Liste meiner Lieblingsstellen. Deswegen nur ein kleiner Ausschnitt:
Der Prolog im Himmel:
Der göttlich-teuflische Schlagabtausch zwischen Gott und Mephisto – voller Sticheleien, da beide wissen, dass sie ohneeinander nicht wirken können.
Der Teufelspakt:
„Verweile doch, du bist so schön“ – dieser Satz bereitet mir jedes Mal Gänsehaut.
Die sogenannte Universitätssatire:
Mephisto – verkleidet als Gelehrter – zerlegt im Gespräch mit einem Schüler voller Spott das verkommene Bildungssystem.
Auerbachs Keller:
Faust hat von Mephisto verlangt, weltliche Befriedigung zu erlangen – und bekommt Alkohol, derbe Witze und Lieder geliefert. Die Verstörung Fausts spricht Bände: Das kann es für ihn noch nicht gewesen sein.
Das Duell zwischen Faust und Margaretes Bruder Valentin:
Ja, Mord ist keine Lösung und definitiv verwerflich. Und ja, Faust ist ein furchtbarer Typ. Aber Valentin brilliert leider auch mit Sätzen wie „Ich sag’s dir im Vertrauen nur: Du bist doch nun einmal eine Hur“, die er, während er stirbt, seiner Schwester ins Gesicht schleudert. Mein Mitgefühl hält sich in Grenzen.
(Lektoriert von jub und lurs.)
ist seit Oktober 2024 bei PHILIPP, studiert PoWi und Neuere deutschsprachige Literatur, weiß (fast) alles über die Simpsons und kann "Faust" auswendig zitieren.