Eine Sammlung an Erfahrungen
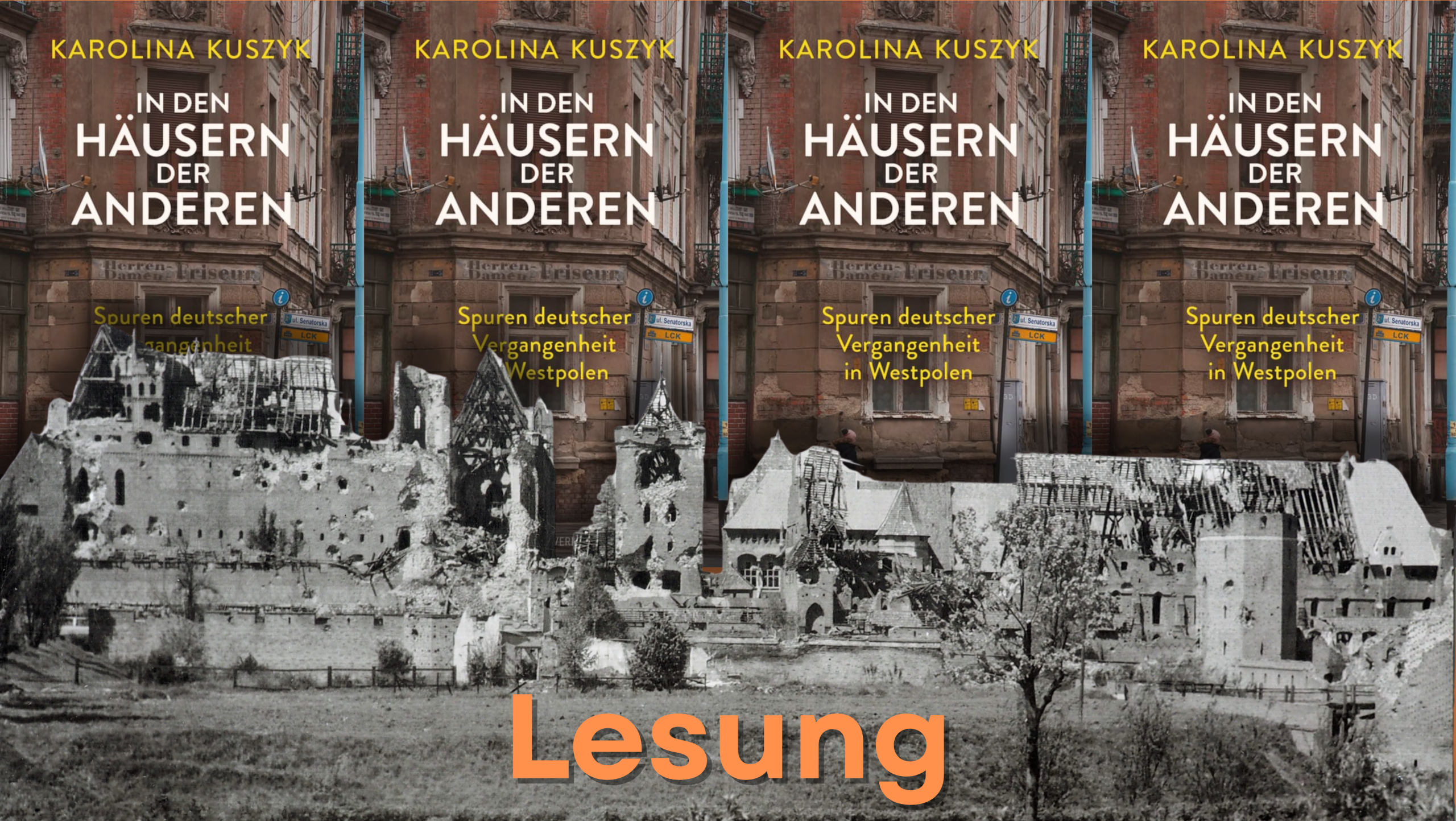
Bild: Laura Schiller
1945: Die Deutschen verlassen die von ihnen besetzten Gebiete in Polen. Zurück bleiben Hinterlassenschaften wie Haushaltswaren, Architektur und Namen. Karolina Kuszyk beschreibt in ihrem Buch die Erfahrungen der Menschen, die in Westpolen tagtäglich mit dem deutschen Erbe konfrontiert werden.
Der Raum füllt sich, sodass kein Platz unbesetzt bleibt – es müssen Hocker für mehr Sitzgelegenheiten herbeigeholt werden. Währenddessen wird eine Präsentation mit einer Abfolge an Fotografien von Orten in Westpolen gezeigt. Vor Beginn der eigentlichen Vorlesung wird dem Herder-Institut für die Ausrichtung der Lesung gedankt. Moderator Hans-Jürgen Bömelburg stellt dem Publikum die Autorin Karolina Kuszyk vor.
Auf dem Weg zwischen Kulturen
Kuszyk ist in Niederschlesien in Westpolen geboren und aufgewachsen. Ein Gebiet, das bis zum Jahre 1945 von Deutschen besetzt war. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die Deutschen aus Niederschlesien vertrieben und Menschen aus Ostpolen wurden nach Westpolen zwangsumgesiedelt. Karolina Kuszyk ist für ihr Studium nach Warschau gezogen. Mittlerweile wohnt sie in Berlin und arbeitet als Literaturübersetzerin, Lehrbeauftragte und Autorin. Ihr Buch In den Häusern der Anderen hat sie im Polnischen bereits 2019 veröffentlicht mit dem Originaltitel Poniemieckie, was so viel wie „nachdeutsch“ bedeutet. Das Buch wurde mit dem Titel In den Häusern der Anderen von Bernhard Hartmann übersetzt und im Jahr 2022 veröffentlicht.
Erinnern, übersehen, hinterfragen
Der Moderator beginnt die Lesung mit der Frage an die Autorin, wie diese auf das Thema gekommen sei. Sie erzählt von ihrer Herkunft Niederschlesien und der Sehnsucht nach ihrer Heimat während des Studiums in Warschau. Dabei hinterfragte sie ihr Heimweh, da ihr Zuhause voll mit deutschen Hinterlassenschaften ist. Im Buch beschreibt sie das Verhältnis zu dem Einfluss, den die Deutschen in Westpolen hatten.
Die erste Passage, die sie aus der deutschen Übersetzung vorliest, gehört dem Kapitel Das Hakenkreuz an. Der Textabschnitt beschreibt, wie sie und ihr Mann ihre Familie in Niederschlesien besuchen. Ihr Mann entdeckt auf dem Boden einer Schüssel ein unscheinbares, kleines, grünes Hakenkreuz. Ihr Mann – mit deutscher Herkunft – ist regelrecht schockiert von dem Zeichen. Sie hingegen bemerkt, dass ihr das Hakenkreuz bisher nie wirklich aufgefallen ist, wie auch andere deutsche Gegenstände in ihrer Heimat, die sie nie hinterfragt hat.
In Folge der Vertreibung der Deutschen gab es den Versuch, Westpolen zu „entdeutschen“. Dabei wurden deutsche öffentliche Gebäude oft eingeebnet oder verwilderten. Die deutschen Alltagsgegenstände, welche in den Häusern zurückblieben, wurden zu verkaufen versucht. Diese Erklärung gab der Moderator im Zusammenhang zu seiner nächsten Frage an die Autorin: Warum findet man noch so viele deutsche Hinterlassenschaften in den Häusern Westpolens? Karolina Kuszyk beschreibt, dass die erste Generation, die nach Westpolen zwangsumgesiedelt wurde, schlichtweg größere Sorgen hatte – den Kampf ums Überleben. Die Kinder dieser Generation hatten kein Interesse an den Hinterlassenschaften Deutscher und wollten ihren Blick nach vorne richten. Die dritte Generation, der die Autorin selbst angehört, begann langsam die deutschen Hinterlassenschaften zu hinterfragen.
Unterschiede in der Auffassung?
Bömelburg stellt seine nächste Frage: Ist die Auffassung der deutschen und polnischen Leser*innen ähnlich? Karolina Kuszyk erklärt, dass die Auffassung des Buches sich in den zwei Ländern sehr unterschieden habe. In Polen habe das Buch im Großen und Ganzen positive Reaktionen hervorgerufen, da über das deutsche Erbe in Polen normalerweise nicht so unbefangen gesprochen werde. Viele erkannten sich in den Erfahrungen aus dem Buch wieder, sodass es identitätsstiftend gewirkt habe – insbesondere für Menschen aus Westpolen. In Deutschland eröffnet das Buch eine ganz neue Perspektive und bietet daher einen Lerneffekt für die Leser*innen.
Die folgende Passage, die Kuszyk vorliest, stammt aus dem Kapitel Dinge, das von der Disziplin erzählt, die durch deutsche Kinderbücher vermittelt wird. Einem polnischen Jungen wird von seinem deutschsprachigen Kindermädchen die Geschichte „Max und Moritz“ vorgelesen. Er versteht zwar kein Deutsch, kann die Geschichte aber durch die Bilder erfassen. Der Junge ist irritiert, ob er sich freuen soll, dass die zwei für ihre Taten bestraft werden oder ob er traurig sein und Mitleid für die Jungen empfinden soll. Polnische Kinder bekommen sonst oft schöne und liebenswürdige Geschichten erzählt, was im starken Kontrast zu den deutschen Kinderbüchern steht. In der Passage wird eine weitere Hinterlassenschaft der Deutschen beschrieben – die Disziplin. Dazu wird aus der Zuhörerschaft ergänzt: die Klopfpeitsche. Karolina Kuszyk liest vor, dass diese über den Türen der Kinderzimmer hingen, zwar selten bis überhaupt nicht genutzt wurden, aber den Kindern dennoch Furcht eingeflößten.
Gemeinsames erinnern
Am Ende bekam das Publikum die Chance, Fragen an die Autorin zu stellen. Dabei fiel auf, dass viele im Publikum entweder selbst oder ihre Eltern oder Großeltern aus dem Gebiet kommen. Viele erzählten Anekdoten von ihren Familien, die in Westpolen lebten, und bedankten sich, dass Kuszyk die Erfahrungen und Gefühle, die sie selbst auch zu diesem Thema empfinden, zu Wort gebracht hat.
Eine Frage an die Autorin lautete: Warum sind so viele Wohnungen nach der Vertreibung der Deutschen unverändert geblieben? Karolina Kuszyk erklärt, dass einige Pol*innen geglaubt haben, dass die Deutschen zurückkehren und ihre Wohnungen wieder beanspruchen würden.
Wie wurden die Wohnungen in Niederschlesien an die Pol*innen bei der Zwangsumsiedlung verteilt? Zur Beantwortung dieser Frage liest Kuszyk eine weitere Passage aus dem Kapitel Der Kampf um Wohnungen, worin die chaotischen Zustände aufzeigt werde. Es galt das Recht des Stärkeren: Wer sich zuerst durchsetzt und eine Wohnung erfolgreich besetzt, bekommt diese auch. Aufgrund von Plünderungen und Kämpfen wurden in den gefundenen Wohnungen Barrikaden und Nachtwachen zur Verteidigung eingesetzt. In anderen Städten hingegen suchten die Menschen gemütlich Wohnungen aus und konnten viele aufgrund von Kleinigkeiten wie zum Beispiel der Farbe des Flügels ablehnen. Diese Unterschiede bei der Verteilung ergaben sich aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel durch die Anzahl der verfügbaren Wohnungen und der Umsiedler, den Zerstörungsgrad der Städte oder die Handlungsfähigkeit der jeweiligen Verwaltungen.
In den Häusern der Anderen zeigt eine neue Perspektive auf, wenn es um Umstände nach dem Zweiten Weltkrieg geht. Es ist ein Buch, das die langfristigen Folgen der deutschen Besatzung Polens im Zweiten Weltkrieg beschreibt.



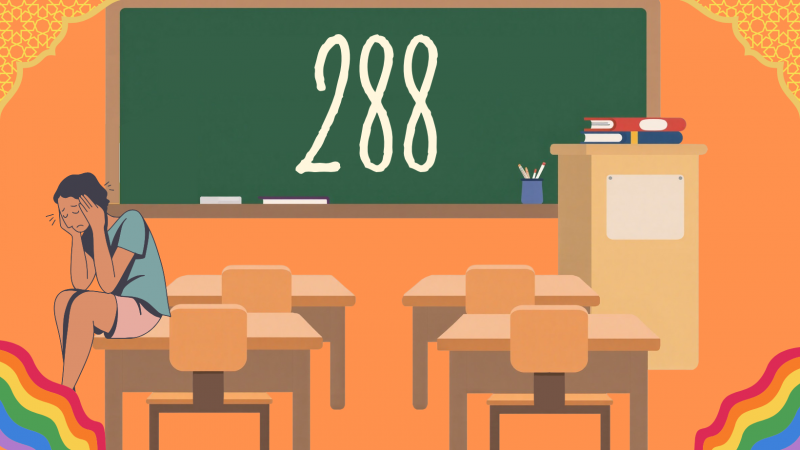


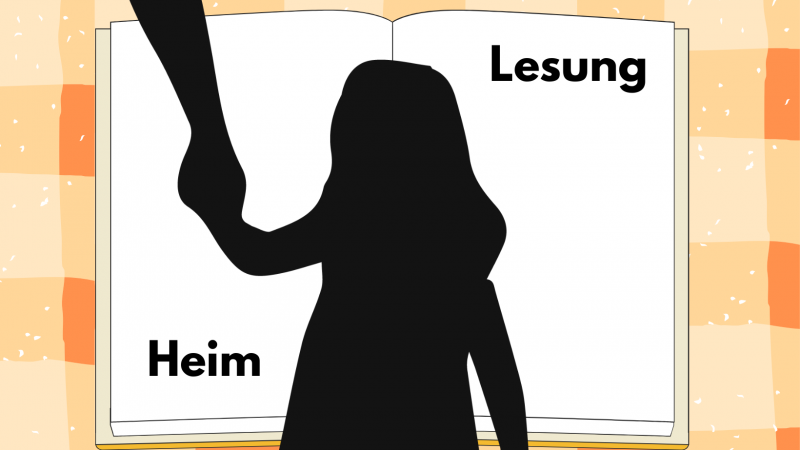
Die Lesung war sehr beeindruckend! Es bot sich ein einzigartiger Einblick in die polnische Perspektive der Machkriegszeit und das Nachwirken der damaligen Entscheidungen.
Dieser Artikel fängt das sehr schön ein! 😀