Wo alles zu Staub wird: „Antigone“ im HLTM

Foto: Jan Bosch; Collage: Laura Schiller
Hinweis: Die Rezension enthält Spoiler.
Triggerwarnung: Die Inszenierung und der Artikel thematisieren Tod, Suizid und Krieg.
Eine dunkle Bühne. Umhüllt von Nebelschwaden und begleitet von Chorgesängen treten schemenhaft zwei Personen hervor. Die eine schleppt die andere unter verzweifelten Lauten quälend langsam an den Bühnenrand, versucht den scheinbar leblosen Körper immer wieder aufzurichten.
Eine Antwort auf die Ohnmacht
Mit Sophokles’ Antigone eröffnete das Hessische Landestheater Marburg am 20. September 2025 die neue Spielzeit unter dem Motto „Take Care! Füreinander, miteinander“. Die Intendantinnen Eva Lange – die auch bei Antigone Regie führt – und Carola Unser-Leichtweiß geben den Rahmen vor: Theater soll in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist, voller Kriege, politischer Hetze und Queerfeindlichkeit nicht verstummen, sondern bewegen, erschüttern und zur Diskussion anregen. Sie appellieren an das Publikum, diese Welt nicht aufzugeben, sondern laut zu sein und zu verändern, auch wenn Angst und Ohnmacht herrschen. Ihren Appell kann man in der dramatischen Bühnendarstellung direkt miterleben.
Was sich im bläulichen Licht entfaltet, ist eine monochrome Welt in Schutt und Asche – die Stadt Theben im Nachkriegszustand. Graue Wände wie Rohbeton, Schutthaufen, ein Baugerüst. Und überall Staub: In den Kostümen, in den Gesichtern, in den Haaren, im Nebel, entfaltet er sich zu einer ewig wirbelnden Staubwolke.
Antikes Familiendrama deluxe
Die komplizierten Familienverhältnisse erschweren den Einstieg, daher kurz zur Orientierung: Antigone (AdeleEmil Behrenbeck) und Ismene (Saskia Boden-Dilling) sind die Töchter von keinem geringeren als König Ödipus und seiner Frau Iokaste. Richtig, das ist der tragische König, der unwissentlich seine Mutter geheiratet hat und nach dem Freuds berühmter Ödipuskomplex benannt worden ist. Antigones Brüder Polyneikes (Faris Saleh) und Eteokles haben sich im Kampf um den Thron Thebens gegenseitig getötet. Polyneikes gilt seitdem als Verräter. Antigones Onkel Kreon (Christian Simon) wird Herrscher in Theben. Sein Sohn Haimon (Luca Storn) ist Antigones Verlobter und ihr Cousin – ja, es klingt alles wie eine antike, griechische Version von Game of Thrones. Kreon verbietet die Bestattung Polyneikes’ und stellt sich und das Gesetz damit über die göttlichen Gebote. Wer sich dagegen wehrt, soll hingerichtet werden.
Es lebe das Patriarchat!
Zurück zum Ausgangsgeschehen auf der Bühne: Antigone trägt den Leichnam ihres Bruders Polyneikes zum Bühnenrand, um ihn zu bestatten. Sie will sich Kreons Gesetz widersetzen, da sie sich den Göttern und ihrem eigenen Gewissen verpflichtet fühlt. Ihre Schwester Ismene versucht, sie davon abzubringen. Doch Antigone erwidert nur: „Was ich tun muss, kann man mir nicht verbieten“. Der Chor (Ulrike Walther), der in der griechischen Tragödie als kommentierendes Bindeglied zwischen Publikum und Bühne dient, erzählt auf der Bühne nun von den Hintergründen des Krieges und vom Tod der beiden Brüder Antigones.
Kreon regiert in Theben wie ein Autokrat, der jede Bedrohung seiner Macht mit Gewalt beantwortet. Für ihn ist Antigone nicht nur eine Verbrecherin, sondern auch eine Frau, deren Einfluss er fürchtet. Diese gesteht ihren Gesetzesbruch vor Kreon, sagt jedoch auch, dass sie vor den Göttern richtig gehandelt hat und deswegen bereit ist, vor dem Gesetz zu büßen. Sie wird von Kreon zum Tod durch Begraben bei lebendigem Leib verurteilt. Kreon verachtet Antigone, sieht die Frau als Ursprung des Verderbens und fängt nun an, seinem Sohn recht fragwürdige Beziehungstipps zu geben. Er stellt Haimon vor die Wahl zwischen Frau und Verstand, sieht seinen Sohn unter Antigones Einfluss und weist auf die schädliche „Herrschaft des Weibes“ hin. Hurra! Es lebe das Patriarchat. Haimon aber ergreift Partei für seine Verlobte. Er entlarvt seinen Vater als Egoist, der nur sein eigenes Weltbild akzeptiert. Vater und Sohn prallen als Autokrat und Demokrat aufeinander: Kreon fordert blinden Gehorsam, Haimon hört auf die Stimmen des Volkes, das Antigones Freiheit verlangt. Beide trennen sich im Streit. Erst der Seher Teiresias (Mia Wiederstein) kann Kreon dazu bewegen, Antigone zu befreien, da dieser ihm den Tod in seiner eigenen Familie prophezeit. Doch für Antigone kommt jede Rettung zu spät.
„Unheimlich ist es schon, dieses Schweigen“
Was am Ende übrig bleibt? Entsetzen. Kreon bleibt allein zurück, ein Niemand geworden, apathisch. Der Chor starrt ihn an, fassungslos. Am Anfang wie am Ende hält Antigone den toten Bruder in den Armen – eine Komposition, die den Kreis der Katastrophe schließt. Die Leiche Polyneikes’ liegt das ganze Stück über am Bühnenrand, das Publikum vergisst nie den Konflikt, um den es geht; er ist omnipräsent, genauso wie der Tod.
In Sophokles’ Tragödie Antigone zeigt sich, wie der Konflikt zwischen staatlicher Gewalt und individueller bzw. göttlicher Moral, männlicher Gewalt und weiblicher Selbstbehauptung in einem patriarchalen System eskalieren kann. Männliche Macht wirkt einschüchternd und bedrohlich: Kreon taucht immer wieder wie ein dunkler Schatten hinter Antigone auf. Wer die Gewalt in Frage stellt, wird bestraft. Antigone betreibt zivilen Ungehorsam, bleibt standhaft, aber Kreon ebenso. Er versucht, eine Gesellschaft in einer Welt zu lenken, die aus den Fugen geraten ist. Beide handeln aus der festen Überzeugung ihrer eigenen Wertmaßstäbe heraus und scheitern am Ende an ihrer Hybris. Gewalt löst eine vernichtende Kettenreaktion aus, führt zur Katastrophe und zeigt die Begrenztheit der menschlichen Existenz, was auch durch das Bühnenbild symbolisiert wird. Zu Beginn erscheint die Bühne noch weit, doch am Ende engen die Wände die Figuren ein, ihr Wirken ist beendet. Antigone stirbt als Verfechterin ihrer Prinzipien und erhält dadurch Ruhm, denn sie stirbt für die Ehre ihres Bruders. Ihr Tod markiert gleichzeitig das Ende einer ganzen Familientragödie, am Ende ist Ödipus’ Zweig ausgelöscht.
Warum Antigone wirkt
Trotz der Schwere bleibt der Abend erstaunlich kurzweilig: In eindreiviertel Stunden entfaltet sich die Tragödie dicht und kraftvoll. Antigone hält einer Welt den Spiegel vor, in der Machtmissbrauch, Krieg und Moral übersehen werden. Keine leichte Kost, aber genau deshalb leisten die Schauspieler*innen in ihrer Figureninterpretation Großes. Christian Simon als Kreon erscheint als bedrohliche Macht, für die man aber dennoch Verständnis aufbringen kann, und die in ihrer Überkompensation schließlich klein wirkt. Die Verzweiflung von AdeleEmil Behrenbecks Antigone hingegen geht durch Mark und Bein. Die Ambivalenz im Figurenhandeln ist fantastisch, zwischendurch weiß man nicht mehr, wen man eigentlich verachten und wen bewundern soll. Besonders gelungen ist auch das wiederholte Durchbrechen der sogenannten vierten Wand: Beispielsweise, wenn Kreon im Tonfall einer Herrscherrede direkt ans Publikum spricht, rückt die Katastrophe beklemmend nah.
Antigone ist in der Thematik zeitlos. Ziviler Ungehorsam, überdominante Herrscher, Familienfehden, Krieg und Tragik. Auf beeindruckende Weise schafft es die Inszenierung genauso zeitlos zu wirken wie der Stoff. Sie zeigt, dass ein Text, der 442 v. Chr. geschrieben wurde, ohne großes Beiwerk noch heute Relevanz besitzt. Sophokles’ Tragödie darf für sich selbst sprechen, und das funktioniert auch 2025 immer noch hervorragend. Die triste Schlichtheit von Bühnenbild und Kostümen lenkt die Aufmerksamkeit auf die Sprache und die schauspielerische Leistung, die trotz antiker Dialoge klar verständlich bleibt. Diese Schlichtheit, verbunden mit der Atmosphäre einer Gesellschaft im Krieg, macht die Inszenierung so bedrückend aktuell. Damit trifft sie genau den Ton des Spielzeitmottos: Antigones Ausruf „Nicht zu hassen, zu lieben bin ich da“, klingt wie eine Antwort auf den Appell der Intendantinnen, dem Glauben an ein Miteinander nicht aufzugeben. Doch Antigones Aufbegehren gegen Willkür und Kreons verzweifeltes Ringen nach Ordnung erinnern daran, dass ein Miteinander auch immer wieder neu verteidigt und gelebt werden muss.
Und dann ist da immer wieder dieser Staub. Er legt sich auf alles sowieso Eingestaubte: Das politische System, die zerstörte Stadt, das Patriarchat, die Tyrannei. Übrig ist nur die Vergänglichkeit des Menschen – im wahrsten Sinne: „Asche zu Asche, Staub zu Staub.“
Antigone läuft noch bis zum 7. November im Erwin-Piscator-Haus.
(Lektoriert von lurs und ans.)
ist seit Oktober 2024 bei PHILIPP, studiert PoWi und Neuere deutschsprachige Literatur, weiß (fast) alles über die Simpsons und kann "Faust" auswendig zitieren.




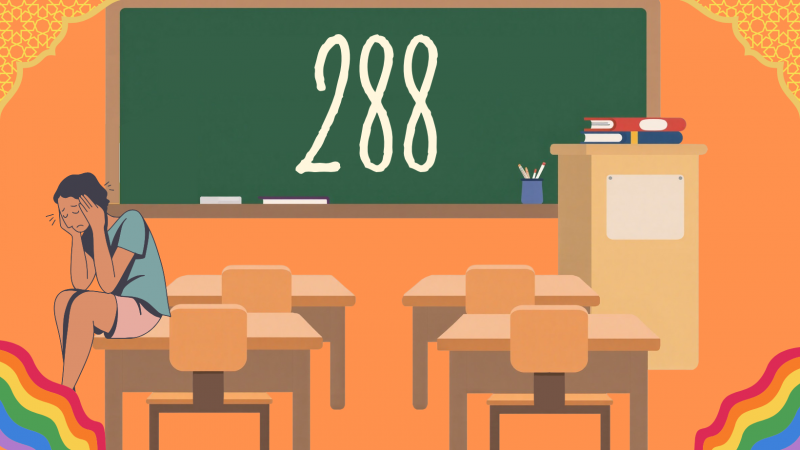


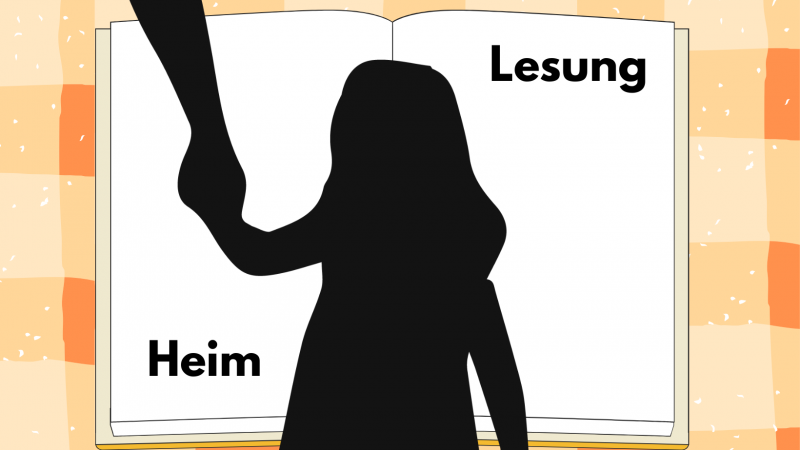
Vielen lieben Dank für diese so umfassende Würdigung unserer Arbeit! Danke! Wir sind gespannt auf weitere Zuschauer*innenkommentare. Das Hessische Landestheater Marburg