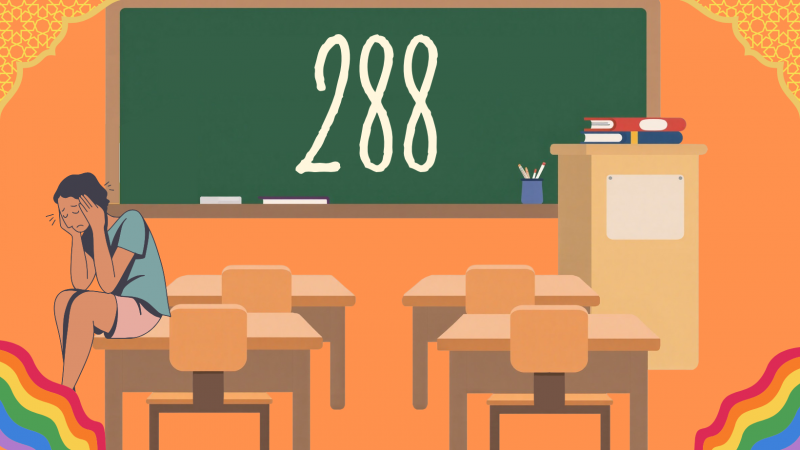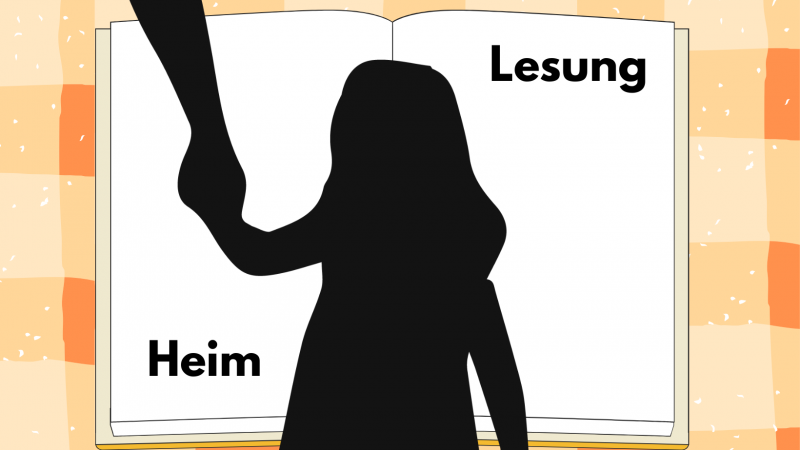An der Schwelle zur Offenbarung

Foto: Jan Bosch; Collage: Laura Schiller
Tony Kushners Bühnenstück Engel in Amerika (in der Übersetzung von Frank Heibert) ist ein episches, langes und aufwühlendes Stück, das als moderner Klassiker gilt. Die HLTM-Inszenierung unter der Regie von Joachim Goller feierte am 27. September Premiere. Unsere Redakteurin Laura war für PHILIPP dabei.
„New York City, Oktober 1985. Schlechte Nachrichten.“ Der republikanische Präsident Ronald Reagan ist in seiner zweiten Amtszeit, das Land, dieser „Schmelztiegel, wo nu’ gar nichts schmilzt“, ist gezeichnet von McCarthyismus¹ und Korruption, die Bevölkerung sehnt sich nach Freiheit und Demokratie, nach dem pursuit of happiness und nach Heimat. Eine der zentralen Figuren in Engel in Amerika, der jüdische Textverarbeiter Louis (Andreas Hammer), hat allerdings noch ganz andere Probleme. Nach der Beerdigung seiner Großmutter zeigt ihm sein Freund Prior (Georg Santner) den „rotweindunklen Kuss des Todes“ auf seinem Arm. „KS, Schätzchen“,² sagt Prior mit vorgetäuschter Leichtigkeit – wie viele andere homosexuelle Männer ist er an AIDS erkrankt. Louis zerbricht an seiner Angst und ergreift die Flucht.
Neben Louis und Prior reihen sich 18 weitere Figuren in den Reigen ein, die von acht Darsteller*innen verkörpert werden, so wie es der Autor des Stücks vorsah. Kushners Epos Angels in America – A Gay Fantasia on National Themes besteht aus zwei Teilen: Die Jahrtausendwende naht und Perestroika, die beide innerhalb von drei Stunden (exklusive Pause) aufgeführt werden. Dabei wurde bereits stark gekürzt – eine Aufführung der Originalfassung kann sieben bis acht Stunden dauern. Das Stück wurde 1991 in San Francisco uraufgeführt und erhielt zahlreiche Preise. Viele große Themen werden in diesem kontemporären Klassiker aufgegriffen: Liebe, Hass, Tod, Religion, Spiritualität, (mentale) Gesundheit, Queerness, Demokratie, Gerechtigkeit, Antisemitismus, Rassismus, Intersektionalität, Zerfall und Freiheit. Ein ambitioniertes und mutiges Projekt ist es also, dieses lange, schwierige Werk auf einer kleinen Bühne im Theater am Schwanhof zu inszenieren.
„Homosexuelle und Drogenabhängige“
Besonders relevant für das Stück ist der Anwalt Roy Cohn (Sven Brormann), der auf einer realen Person basiert – ein geistlicher Sohn Joseph McCarthys, ein Lehrer Donald Trumps. Ein absolut verabscheuenswürdiger, hinterhältiger und cholerischer Mann, der nicht selten in Wutanfälle ausbricht und der seine Homosexualität und seine AIDS-Erkrankung bis an sein Lebensende leugnet. In der Gefolgschaft und im Schatten Cohns steht Joe Pitt (Tobias Neumann), „ein schwuler, republikanischer, mormonischer, sensibler Anwalt“. Er kann sich ebenso schwer seine Homosexualität eingestehen, worunter seine Ehe zu der Valium-abhängigen, halluzinierenden Harper (Lisa Grosche) leidet. Roy Cohn bietet ihm einen Job im Justizministerium an, doch aufgrund des Zustands seiner Frau zögert er, ihn anzunehmen. Auf der Toilette lernt er Louis kennen und beginnt eine Affäre mit ihm. Währenddessen verlieren sich Harper und Prior gemeinsam in ihren Halluzinationswelten, angeleitet von, respektiv, dem imaginierten Touristik-Angestellten Mr. Lies (David Zico), der Harper das Ozonloch zeigen möchte, und dem Engel Amerikas (Greta Plenkers), der Prior für den nächsten großen Propheten und Retter hält. Aus Salt Lake City angereist kommt schließlich noch die streng gläubige Mutter von Joe, Hannah (Solveig Krebs), die versucht, sich um die verlassene, verstörte Harper zu kümmern und auch zur überraschenden Vertrauensperson Priors wird.
„Es gibt kein Zion, außer wo ihr seid“
Mit der Trennung von Louis und Prior trennt sich auch die weltliche von der spirituellen Ebene des Stücks, die dennoch miteinander verflochten bleiben. Louis verfällt einige Male in politische Tiraden, denen nur schwer zu folgen ist. Er kritisiert die scheinheilige Toleranz der Liberalen, hinter der nur mehr Hass versteckt sei, und bedauert die Spaltung des Landes. Währenddessen ist Prior auf anderen Bewusstseinsebenen angekommen. Von der Krankheit zerrüttet und niedergeschlagen erhält er die Prophezeiung des Engels, der apokalyptische Parabeln spuckt, die Prior verzweifelt versucht abzulehnen: „Ich bin kein Prophet, ich bin ein kranker, einsamer Mensch!“ Das Stück steigert sich vor allem im zweiten Teil immer mehr in eine surrealistische Bildwelt, in der Urbanität und Spiritualität, Heimsuchung und Lebensrealitäten aufeinanderstoßen und sexuelle Szenen mit prophetischer Erleuchtung korrespondieren. Dabei behält es eine unfassbare Klarheit, selbst wenn Louis’ politisches Schimpfen genauso überzeichnet ist wie Priors orgasmische Illumination.
Alle acht Darstellenden glänzen mit herausragender schauspielerischer Leistung, sodass es schwerfällt, eine*n unter ihnen besonders hervorzuheben. Grosche verleiht der bemitleidenswerten, verzweifelten Harper, deren Halluzinationen oft für Lacher gespielt werden, Ehrlichkeit und Handlungsmacht. Santner gibt als Prior wirklich alles. Er weint, schreit, singt lauthals und leidet – so viszeral und laut, dass man ihm gerne seine Schmerzen nehmen würde und er trotz der übernatürlichen Ereignisse, die ihm widerfahren, zur Identifikationsfigur wird. Joe, Louis und Roy müssten eigentlich durch ihre Taten verachtungswürdig und unsympathisch sein, dennoch bringt man durch die ehrliche und menschliche Darstellung von Neumann, Hammer und Brormann Mitgefühl für sie auf und kann sie (fast) nachvollziehen. Der Krankenpfleger Belize wird ebenfalls von Zico gespielt und bietet ein bodenständiges und zärtliches Gegengewicht zu der Überheblichkeit anderer Figuren. Auch der Engel, der von Plenkers verkörpert wird, bringt Leichtigkeit und Humor in ein ansonsten recht schweres Stück.
Ein besonders schöner Moment ist jedoch, als Krebs’ Hannah Pitt, die Prior nur durch Zufall begegnet, versucht, ihn bei einer seiner Heimsuchungen zu trösten. Eigentlich hätte man sie schnell als bigotte Mormonin abstempeln können, denn mit der Homosexualität ihres Sohnes kann sie zunächst nicht umgehen. Doch gegenüber Prior zeigt sie sich mütterlich und liebevoll. „Alles wird gut“, versichert sie ihm, während sie seinen Kopf tätschelt. Obwohl nur so daher gesagt, ist es der Trost einer Mutter für einen verlassenen Sohn und zeugt von ihrem Glauben daran, dass, obschon die Dinge düster aussehen, sich alles wenden kann. Es gibt keinen expliziten Sympathieträger in Engel in Amerika – alle Figuren sind auf fast erschreckende Weise menschlich und facettenreich. Keine Klischees, keine Überzogenheiten, nur echte Gefühle, nahbares Leid und erlebbares Glück.
„Zerfasert ist der Stoff des Himmels“
Durch die Ebenerdigkeit des kleinen Theaterraumes ist das Publikum dem Geschehen teilweise unangenehm nah – sehr laute Streitszenen und Schmerzensschreie machen das Stück an einigen Stellen etwas akustisch überladen und überstimulierend. Allerdings verschafft diese Nahbarkeit auch eine schwer replizierbare Intimität, die durch das Brechen der vierten Wand und provozierten Augenkontakt zum Publikum noch verstärkt wird. (Einfacher Tipp: Nicht in der ersten Reihe sitzen, es sei denn, man möchte wirklich drin sein.)
Um etwas mehr Raum zu schaffen, wurden auf der Bühne Balustraden aufgebaut, die zum einen die Urbanität New Yorks darstellen sollen, zum anderen die Möglichkeit zum gleichzeitigen Erzählen bieten. Einmal gibt zum Beispiel Prior auf der oberen Ebene im langen Kleid und in violettes Licht getaucht eine schrecklich-schöne Darbietung von „Memory“ aus Cats, während Harper versucht, im Hochzeitskleid die Balustrade zu erklimmen, Louis darunter um seine Beziehung trauert und Joe seine Sexualität hinterfragt. Auch bieten die Ebenen (symbolische) Trennwände, die die Isolation von einigen Figuren deutlich machen. Neben dem kahlen Bühnenbild wirken Licht- und Nebeleffekte umso stärker, vor allem das erste Auftreten des Engels und die beeindruckende Schlusspassage, in der sich auch durch die Kostüme von Jenny Schleif eine außergewöhnliche Bildgewaltigkeit auftut. In seiner Simplizität allerdings auch besonders schön: Die Beleuchtung des Central Parks bei Nacht sowie herunterrieselnder Kunstschnee, der eine Art zauberhafte Ruhe erzeugt.
„Ihr lebt nicht in Amerika“
Die Stimmung des Stücks changiert konstant zwischen lustigen Passagen – wie zum Beispiel Harpers imaginierte Reise in die Antarktis oder dass Prior bei jeder Begegnung mit dem Engel eine Erektion bekommt – und sehr schwer zu verarbeitender Kost, wie Schmerzensschreie, Krankheit, die das Unerschütterliche zerrüttet, Gnade und Tod, sowie politische und gesellschaftliche Missstände und Korruption. Schwierige, große und beängstigend aktuelle Themen sind es, die in Engel in Amerika mit sprachlicher Gewandtheit und tiefgreifender Bildlichkeit aufgearbeitet werden – die Spaltung des Landes und der (Welt-)Bevölkerung ist heute genauso zu beobachten und auch die gesellschaftliche Toleranz und Akzeptanz füreinander erlebt eine erschreckende Regression. Die Inszenierung wirkt somit zeitlos und universal. Explizit und mutig reflektiert sie das Facettenreichtum der Gesellschaft. Im Zentrum steht dabei jedoch die bedingungslose Menschlichkeit der Figuren und ein klares Plädoyer für Hoffnung, Humanität und Liebe. „Mehr Leben. Das große Werk beginnt.“
Engel in Amerika wird noch bis zum 8. November im Theater am Schwanhof aufgeführt.
¹ Als McCarthyismus bezeichnet man die Unterdrückung liberal denkender, linker Bürger*innen sowie die Panik vor und die Verfolgung von Kommunisten. Als Kommunist beschuldigt zu werden bedeutete oft, dass man seinen Job verlor oder sogar inhaftiert wurde. Die Kampagne des Second Red Scare gegen die Ausbreitung von Kommunismus wurde in den 50ern von dem Republikaner Joseph McCarthy und dem FBI-Direktor J. Edgar Hoover angeleitet und forderte viele unschuldige Opfer.
² KS = Kaposi Sarcoma, eine Form von Krebs der Lymphdrüsen und Blutgefäße, der sich als violette Läsionen auf der Haut deutlich macht und durch eine AIDS-Erkrankung hervorgerufen werden kann.
ist 25 Jahre alt und studiert Literaturvermittlung in den Medien, sieht sich selbst aber immernoch als Anglistin. Sie weiß nichts über vieles, aber alles über Jane Austen. Seit November 2024 in der Chefredaktion tätig.