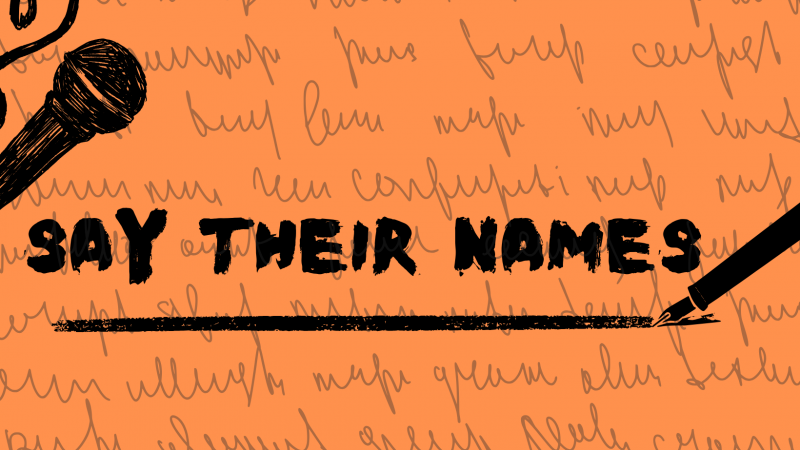Sneak-Review #266: Auf der Suche nach dem roten Faden

Bild: Niklas George
Das Zimmer der Wunder erzählt die Geschichte eines Jungen, der nach einem schweren Unfall im Koma liegt. Seine Mutter versucht, seine Lebenswünsche zu erfüllen, in der Hoffnung, ihn damit wieder zurück ins Leben zu holen. Ein Film, den man schon 100-mal gesehen hat. Oder?
Der Einstieg in den Film: Der dreizehnjährige Louis prügelt sich in der Schule. Als er mit seiner Mutter Thelma nach Hause kommt, wird klar: Die Wohnsituation ist nicht die beste. Thelma arbeitet in irgendeinem Lager, als was genau, weiß niemand. Aber sie scheint nicht viel Geld zu verdienen. Auch der Nachbar von Louis ist dabei, der anscheinend täglich bei ihm zuhause abhängt und zockt. Louis‘ Hobbies sind klar: Skateboard fahren und zeichnen. Zwei schöne Symbole, die immer wieder im Film auftauchen. Doch es kommt, wie es eben kommen muss: Bei einem gemeinsamen Mutter-Sohn-Spaziergang hat Louis einen Unfall und liegt danach für sechs Monate im Koma. Zurück vom Krankenhaus findet Thelma sein Notizbuch, in dem seine Lebenswünsche stehen. Vorhersehbar.
Sehr interessant ist allerdings das Farbschema, das sich durch den gesamten Film zieht und der einzige rote Faden ist, den man findet. Es wird mit den Farben Blau und Gelb gespielt, die bei glücklichen Szenen heller, in traurigen Momenten dunkler sind. Eine schöne Metapher für den Sonnenauf- und -untergang, für Gutes und Schlechtes, für alle Facetten des Lebens eben.
Mit Wünschen um die Welt
Natürlich beschließt Thelma, Louis‘ Wünsche für ihn zu erfüllen. Dafür reist sie bis nach Japan, um sein Skateboard von seinem Lieblingskünstler signieren zu lassen. Halt. Was? Thelma hat eigentlich nicht genug Geld. Die gesamte finanzielle Situation wird im Film nie wirklich aufgegriffen, wir müssen diese Logik einfach schlucken.
In Japan sehen wir die erste von mehreren weirden Szenen: Thelma setzt sich einfach mit auf das Moped von einem Kerl, der sie zu KGI, dem Künstler, bringen will. Thelma, hast du noch nie einen Horrorfilm gesehen? Das ist keine besonders kluge Idee. Es stellt sich heraus, dass KGI eine Frau ist, die das Skateboard natürlich signiert. Diese Auflösung kommt tatsächlich unerwartet, weil vorher impliziert wurde, dass es sich um einen Mann handelt. Ihre Signatur (ein halbes Wolfsgesicht) ist besonders unter männlichen Jugendlichen bekannt.
Das waren aber nicht alle Wünsche: Thelma trifft sich mit Louis‘ Kumpels, die ihr Skaten beibringen. Auch der Nachbar hilft ihr, als sie beim Sprayen einer Wand von der Polizei gefasst wird. Natürlich passiert nichts, der Film dauert ja noch eine Stunde und zwölf Minuten. Irgendwann mischt auch die Oma bzw. Thelmas Mutter mit, von der Thelma Geld erhält. Die Oma erfrischt mit neuem Wind und bewahrt den Zuschauer davor, einzuschlafen. Mit ihrer direkten, schroffen Art spricht sie oft die Gedanken der Zuschauer*innen aus, ohne dabei ihre Herzlichkeit zu verlieren.
Farbdurchtränkte Gefühle
Schön dargestellt wird im Film auch, wie sich Thelma mit jedem Wunsch mehr aus ihrer Komfort-Zone befreien muss, um Louis‘ Liste zu erfüllen. Im Anschluss an die dezent ominöse Suche nach der Künstlerin skatet sie auch noch eine gefährliche Straße am Meer entlang. Natürlich unverletzt. Außerdem nimmt Thelma mit Nachbar Étienne high machende Pilze und erlebt dabei ihren ersten Trip, fasst – natürlich – die Brüste von Louis‘ Lehrerin an und feiert mit dem im Koma liegenden Sohn und seiner Oma das indische Holi-Fest.
Letzteres ist zur Abwechslung weder ein erwartbarer, noch ein unrealistischer Wunsch. Das Holi-Fest ist sogar die schönste und rührendste Szene des Films: Thelma und ihre Mutter verteilen Farbpulver im ganzen Krankenzimmer. Grüne, rote, blaue und gelbe Wolken werden in die Luft gestoßen. Auch hier ist das Blau wieder präsent: Louis‘ Mutter streicht ihm damit übers Gesicht und wünscht ihm Freude und Glück – ein interessanter Kniff, da die Farbe sonst im Film eher als Symbol der Melancholie verwendet wird. Vielleicht auch ein Hinweis auf eine Message: Das Glück ist überall möglich. Selbst in der aussichtslosesten Situation kann die Liebe einem Menschen Kraft und Hoffnung schenken.
Womit wir bei den vielleicht größten Stärken des Films wären: Seine gefühlvolle Art sowie die geniale Darstellung der Protagonistin und besonders der Mutterrolle mit all ihren Hürden. Ihre realistisch dargestellten, komplexen Emotionen und Thelmas rührende Liebe zu Louis machen den Film nahbar und ergreifend.
Vor lauter Fäden keinen Halt
Das wars aber auch schon mit Lob: Denn Logik bzw. Kontinuität spielen im Film eine untergeordnete Rolle. Als Zuschauer*in entsteht nicht selten das Gefühl, der Film selbst verliere in seinen ganzen Handlungssträngen den Überblick. Dadurch verpasst er nicht nur, sämtliche Chancen, Beziehungen oder Inhalte auszuarbeiten, sondern lässt uns auch mehr als einmal völlig perplex in der Luft hängen.
Zum Beispiel als Thelma sich für Louis endlich ihrer größten Angst stellt: Der Kontaktierung seines Vaters, den sie seit ihrer Schwangerschaft nicht mehr gesehen hat und der – wer hätte es gedacht – nichts von der Existenz seines Sohnes weiß. Ohne Vorwarnung verabschiedet sich der gerade aufgegriffene Faden: Die Mutter entscheidet sich kurzfristig dafür, mal eben in Portugal mit Walen zu schwimmen – ohne das Treffen mit dem Vater abzusagen.
Was uns zu einer besonders unausgearbeiteten Szene bringt: Unterstützung beim Tauchen-Lernen bekommt sie von einer Tauchlehrerin, mit der sie sich offenbar sehr (also wirklich sehr) gut versteht … Wow, eine queere Love-Story? In einem Familienfilm?? Let’s goo! Tja, könnte man denken. Da ist definitiv irgendwas zwischen den beiden, wenn sie abends am Lagerfeuer sitzen oder gemeinsam Atemübungen machen. Aber warum sollte man hier etwas ausarbeiten, wenn Thelma auch wieder abreisen und mit dem Privat-Helikopter Louis‘ Vater auf einer einsamen Insel besuchen könnte? Spoiler: Genau das passiert und die neu gewonnene Freundin taucht nie wieder auf.
Inszeniertes Familienglück
Schließlich lohnt es sich, einen Blick auf das Wiedersehen von Louis‘ Eltern zu werfen, denn auch hier wird enttäuscht, wer mit einer halbwegs komplexen Ausarbeitung gerechnet hat: Nach dem Flug zur Insel soll Thelma mit Louis‘ Vater und seiner schwangeren neuen Frau zu Abend essen und ist davon sichtlich mitgenommen. Aber statt ihn über Louis‘ Situation oder auch nur seine Existenz aufzuklären, erwähnt sie beiläufig am Tisch einen Sohn, um danach den perplexen Vater zurückzulassen und an einer Klippe mit einem Wolf um die Wette zu starren. Ja, einem Wolf. Hinterfragt es einfach nicht.
Dennoch, um fair zu sein: So häufig solche inhaltlichen Schwächen auch vorkommen, eines kann Das Zimmer der Wunder wirklich gut. Kameraführung und Musik sind so gut eingesetzt, dass man manchmal gar nicht anders kann, als sich in die Figuren hineinzuversetzen.
Thelmas Rückkehr ins Krankenhaus ist so eine Szene: Mit wallendem Haar und entschlossenem Blick schreitet sie den Gang runter. Die Kamera nah an ihrem Gesicht, die Musik schon fast episch. Sie wirkt abwesend, wie in ihrer eigenen, neu gefundenen Welt. Alle Wünsche ihres Sohnes sind erfüllt, sie ist zu einer neuen Person und Mutter, einer selbstbewussten, unerschrockenen Thelma geworden. Aufgewühlt stürzt sie in sein Zimmer – und fällt ihrem gesunden Sohn in die Arme, der sie aber natürlich nicht wiedererkennt.
Und weil es ja das Finale des Films ist, dürfen wir hier noch einmal den roten Faden erleben, der sich durch die ganze Handlung zieht: Eine spannende Story anzudeuten, um sie danach ohne Vorwarnung zu verwerfen, kurz: keinen roten Faden zu haben. Nach dem ersten Schock springt der Film bequemerweise in die Zukunft, und wir sehen den erwachsenen Louis, der sich mit Mutter und Vater „neue Erinnerungen“ geschaffen und natürlich seine erste Liebe geheiratet hat. Thelma erklärt, der Vater habe Louis kennengelernt und sei sofort mit ihm ausgekommen. Ach ja, Louis ist jetzt der Patenonkel seiner Halbschwester und studiert Medizin. Die glücklichste Familie der Welt eben. Amen.