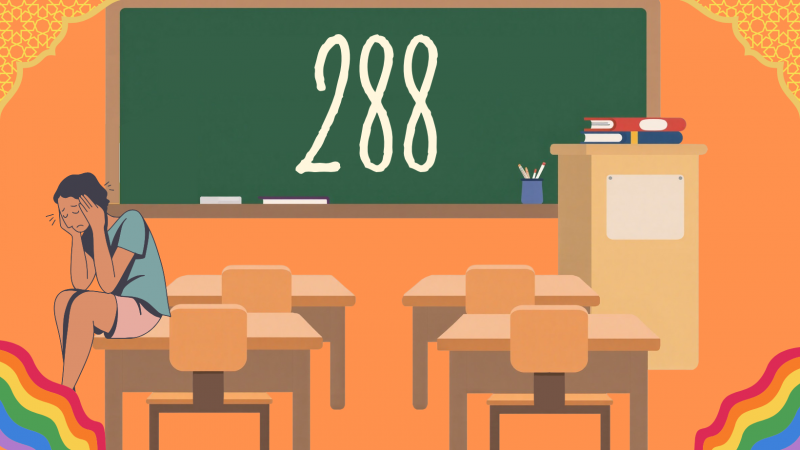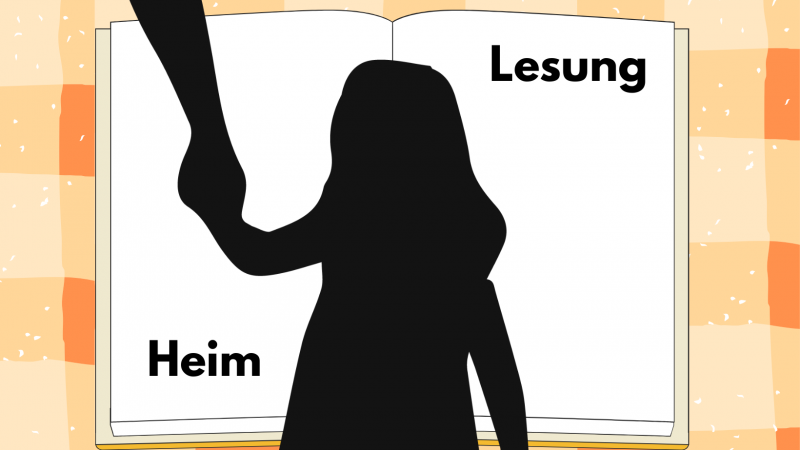Gut gemeint, leicht verwackelt: Über ein Theater, das mehr andeutet als es sagt

Foto: Jan Bosch; Collage: Laura Schiller
Es gibt wenig, das so viel über einen Menschen aussagt, wie die Dinge, die er fotografiert. Die Sachen, die zu vergessen undenkbar wären und dennoch, aus Angst vielleicht auch: Lass mich schnell ein Foto machen, ein Video vielleicht. Zumindest habe ich das einmal so gelesen. Der Abend am Hessischen Landestheater Marburg (HLTM) sollte diese Annahme nur bestätigen. Und doch laufe ich mit einem belustigten Kopfschütteln zum Auto.
Exit through the Polish Shop: ein bescheuerter Titel, nichtssagend, Fragen aufwerfend. So öffnet die Kunstschaffende Iwona Nowacka selbst. Sowieso habe man ihnen den aufgedrängt, ihr Titel sei es nicht. Worum geht es denn jetzt eigentlich?
Zwei Polen erleben den Brexit in London
Der Brexit vor einer polnisch-englischen Leinwand. Genauer: in einem Lädchen im Osten Londons, das große britische Drama seit 2016 in einer polnischen Blase. Weil eben manchmal die kleinen Geschichten die Tragweite der großen besser greifen können und auch, weil dem Künstlerduo ein „Schöpfen aus der Realität“ zuträglicher sei. So zeigen Iwona Nowacka und Janek Turkowski auch hier mit den Schicksalen der Obdachlosen Karol und Michal, wie herzlich und kalt zugleich London sein kann und was es mit dem Satz „Ich mache das, aber nur für den Film“ auf sich hat.
Im Rahmen der Auszeichnung „Borough of Culture“ kommt das Duo nach London, mit dem Datum für den Austritt aus der EU verschiebt sich aber auch die Premiere immer weiter nach hinten. Deshalb nun also diese Perspektive von 2025. Der erste Teil der Arbeit in London kuratiert von William Galinsky, die Fortsetzung nun in Marburg. Und doch fällt die Frage an: Hat sich vielleicht mit dem Termin auch das Thema verschoben?
Die Inszenierung ist handwerklich dürftig
Schlichtes Bühnenbild, schummriges Licht, zwei Tafeln, eine Leinwand. Die Videos aus London dadurch bildlich zerbrochen, manchmal werden die Tafeln verschoben. Soll wohl neue Perspektiven bedeuten, ist aber vor allem eins: undurchsichtig. Amateurhafte Kameraführung, schließlich nicht immer von den Kunstschaffenden selbst, sie teilen ja die Linse. Wobei vielleicht darin der Charme liegt: Auch die anderen Besucher*innen müssen bei dem Gewackel da vorne immer wieder die Augen zukneifen. Aber sie schmunzeln.
Was überzeugt ist das Rattern der Filmrolle und die leisen Stimmen der Befragten. Die Schlichtheit der Inszenierung geht Hand in Hand mit der Schlichtheit der Schicksale. Die Darstellung ist leise und berührend.
Noch schlichter als das Bühnenbild ist die Besetzung. Nowacka und Turkwosky selbst übernehmen die Moderation, leiten uns durch diesen Abend. Abwechselnd auf Deutsch und Englisch berichten sie von ihrer Reise, der Suche nach einer Geschichte und der polnischen Kultur, aber in England. Sie erzählen zahlreiche Anekdoten, darunter auch die einer Demonstration: die Hoffnung, dass „Poland“ vielleicht wie „Holland“ klingt. Angst vor dem Nicht-mehr-Willkommen-Sein und dann die Überraschung. Polen mit seinem Extremismus als Vorbild für den Engländer und wie eng diese Länder doch miteinander verbunden zu sein scheinen. Eine „kleine Variante unseres Brexits“ wollten sie zeigen, erklärt Nowacka.
Ich erwartete von diesem Abend vor allem eines: Politik. Vielleicht ein kritischer Blick auf den Austritt Großbritanniens, vor allem im Nachhinein, schließlich sind einige Jahre ins Land gezogen. Was ich finde, ist etwas ganz anderes. Mit den politischen Auswirkungen des Brexits hat das wenig zutun.
Nicht zu Ende gedacht
Was das Stück stattdessen sagen will? Vielleicht, wie wichtig Familie ist, ohne dabei Verwandtschaft zu meinen. Wie willkürlich Kunstfindung sein kann und wie schön. Wie schwierig es oft ist, Hilfestellung zu geben und anzunehmen. Und vermutlich, dass diese Dinge besonders vor dem Hintergrund von Umbrüchen, Unsicherheiten und Änderungen trittfesten Boden geben.
Was bleibt, ist das Gefühl, dass vieles angedeutet, aber wenig zu Ende gedacht wird. Dass die Inszenierung keine klare Botschaft vermittelt, wirkt zunächst unentschlossen, vielleicht ist es aber gerade diese Unentschiedenheit, die auf eine diffuse Gegenwart reagiert: ein Theater, das nicht weiß, wo es steht. Weil auch die Welt ins Schwanken geraten ist.
Dann erklärt das Duo aus Polen uns, dass man den großen Countdown zum Brexit gar nicht habe filmen können. Die Kamera bricht bei dem überschwänglichen Ausruf „three“ ab. Weil eben andere Dinge wichtiger waren, andere Augenblicke nicht in Vergessenheit geraten durften.
Am Ende bleibt das Bild eines Abends, der vieles andeutet, aber wenig festhält – wie ein verschwommener Schnappschuss. Interessant in der Geste, aber unentschlossen im Fokus. Vielleicht wollte die Inszenierung genau das: die Flüchtigkeit eines Moments, der weniger erzählt als er offenlässt. Ob das reicht, um zu berühren, muss jede*r selbst entscheiden. Wer neugierig genug ist, sich auf ein Theater ohne feste Richtung einzulassen, könnte zumindest mit einem Gedanken nach Hause gehen: Was hätte ich fotografiert?