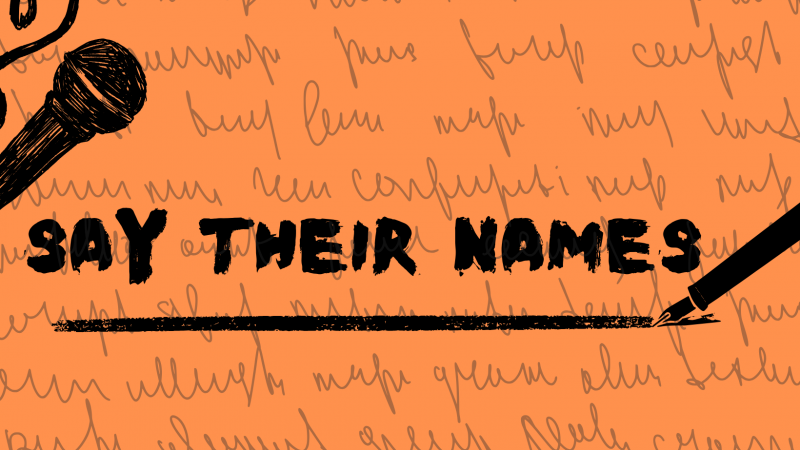Endgegner*in: Leistungsdruck
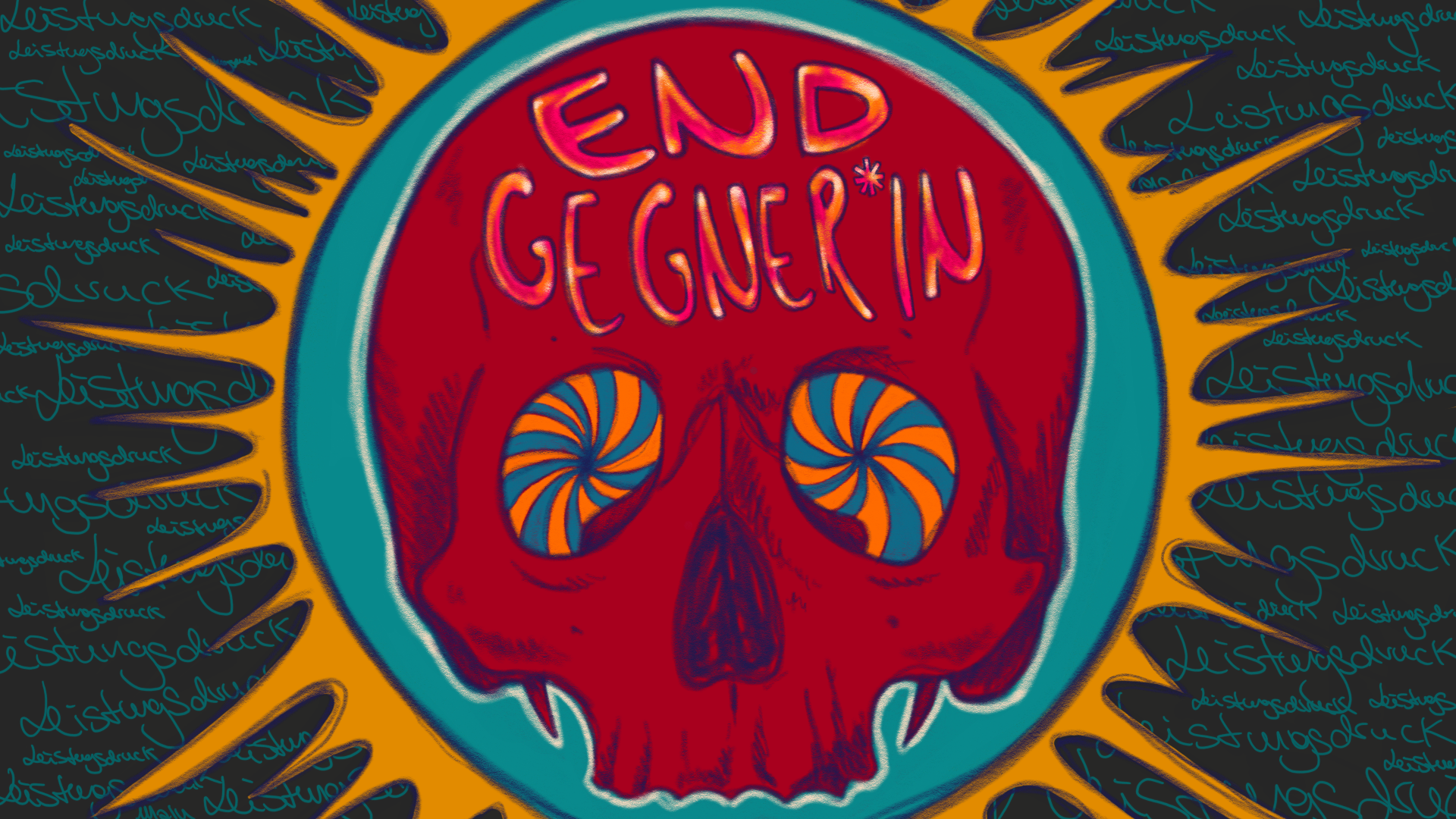
Bild: M. Wolter
Wenn dir das Leben Zitronen gibt, gibt dir die wacklige Internetverbindung oder die Drehtür in der Bib vielleicht noch den Rest – in dieser Reihe schreiben wir über die Endgegner*innen des Unialltags, also Dinge, die Studis an den Rand der Verzweiflung bringen.
Wenn meine Verwandten hören, dass ich studiere, denken sie an rauschende Feste, Fast Food, Alkohol und einen Wecker, der nicht vor 11:30 Uhr klingelt. Was sie nicht sehen, ist mein Herzflattern vor jeder Klausur. Sie sehen nicht die Angst in eine Abwärtsspirale zu geraten, die aus Letztversuchen und drohender Exmatrikulation besteht. Sie sehen nicht, wie ich wochenlang nachts aufwache, nachdem ich schon wieder davon geträumt habe, wie mein Professor mich in der letzten mündlichen Prüfung für das Nichtbestehen schlecht geredet hat. Sie sehen nicht mein Zimmer, das vor lauter ungewaschenen Klamotten und Post-It-Notes an jeder glatten Oberfläche gar nicht mehr als Zimmer zu erkennen ist, oder die Tatsache, dass ich meine erste Mahlzeit oft nicht vor fünfzehn Uhr einnehme und mein Abendessen dann aus den paar Salzstangen besteht, die bei der abendlichen Redaktionssitzung die Runde machen.
Das Studierendenleben, wie es sich die Elterngeneration von Arbeiter*innenkindern oft vorstellt, ist bei genauerem Hinsehen oft weniger sorgenfrei und verantwortungslos, als Außenstehende annehmen. Auf vielen Studierenden lastet neben dem akademischen Druck noch die Notwendigkeit eines Nebenjobs, um die Miete, das wahnsinnig teure Semesterticket und den Lebensunterhalt zu finanzieren. Und dann steht man zu oft vor der Wahl: Opfert man die letzte verbliebene Freizeit am Wochenende, um zu Arbeiten oder müssen die Semesterferien zum Aufstocken des Kontos herhalten?
Im ersten Semester kam ich häufig heim und verspürte nichts außer Antriebslosigkeit. Ich sollte die Unordnung in meinem Zimmer beseitigen, die Wäsche waschen, obwohl unsere Waschmaschine immer belegt zu sein scheint. Ich sollte kochen, anstatt mit Vitamintabletten zu versuchen, über meine schlechte Ernährung hinwegzutäuschen und selbstverständlich sollte ich vor allem früher angefangen haben zu lernen. Natürlich lag das primär daran, dass ich das erste Semester maßlos unterschätzt habe. Aber auch jetzt, ein paar Semester später, eine Prise Erfahrung reicher, kann ich mir an manchen Wochenenden nicht mal die Heimfahrt mit dem Zug zumuten. Die Bahn ist üblicherweise viel zu überfüllt und das gratis WLAN viel zu schwach für eine richtige Lernsession. Und trotzdem stehe ich manchmal im Gang, zwei Reisetaschen zwischen die Beine geklemmt, schweißgebadet im Wintermantel, da die Bewegungsfreiheit fehlt, um diesen auszuziehen. Mit einer Hand halte ich mich fest, in der anderen halte ich ein Taschenlehrbuch. Ob das effektiv ist, kann ich nicht sagen, aber es beruhigt mein schlechtes Gewissen.
Studieren ist ein Privileg und als erste und einzige Person in meiner Familie mit höherem Bildungsabschluss, wird mir das umso häufiger vor Augen geführt. Umso größer ist die Angst, zu enttäuschen. Ich will die Chance nutzen, um die ich mich so bemüht habe. Ich will mein Bestes geben, aber manchmal ist mein Bestes nur die sechsstündige Pflichtveranstaltung an einem Tag zu besuchen und danach erschöpft ins Bett zu fallen, anstatt noch den Gong in der Bib abzuwarten, der nach einem hochproduktiven Tag das wohlverdiente Ende einläutet.
Ich liebe mein Studium und ich würde mich jedes Mal aufs Neue wieder für das Studieren entscheiden, aber wenn meine Lehrbücher wegen des tränengetränkten Papiers auf eBay nur noch zum Verschenken gut sind, meine Eltern wochenlang nicht von mir gehört haben und ich beim nächsten Heulkrampf die Uhr im Blick behalte, um nicht alles mit verminderter Lernzeit noch viel schlimmer zu machen, fällt es mir schwer, mich über mein Privileg freuen zu können.
Es fällt mir schwer, alles unter einen Hut zu bringen. Neben dem Studium kostet es auch Kraft, soziale Kontakte zu pflegen, regelmäßig die Oma anzurufen und neue Menschen kennenzulernen. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass ich mir in vielen Modulen nur einen Fehltermin im Semester leisten darf und demnächst mit Fieber und Reizhusten im Seminar stehen und Referate halten werde. Work-Life-Sleep-Balance ist nicht so leicht, wie die Ikea-Werbung es uns zu verkaufen versucht und ein 794 Euro Boxspringbett aus Pressspanplatten und 100% Polyesterbezug ist nicht der Schlüssel zu meiner Mental Health. Aber anstatt noch mehr Vorwürfe und schlechtes Gewissen anzuhäufen, versuche ich einfach, so gut es geht weiterzumachen und mich daran zu erinnern, dass ich schon viel hinter mich gebracht habe, um daraus Kraft zu schöpfen.
Die ältere Generation hält uns für verweichlicht, kein bisschen stressresistent. Aber für die Meisten bedeutet studieren nicht, sich vor ehrlicher Arbeit zu drücken, sondern sich mehr Möglichkeiten für ehrliche Arbeit in der Zukunft zu schaffen. Vielleicht ist das das neue Studierendenleben? Stress statt Saufen.