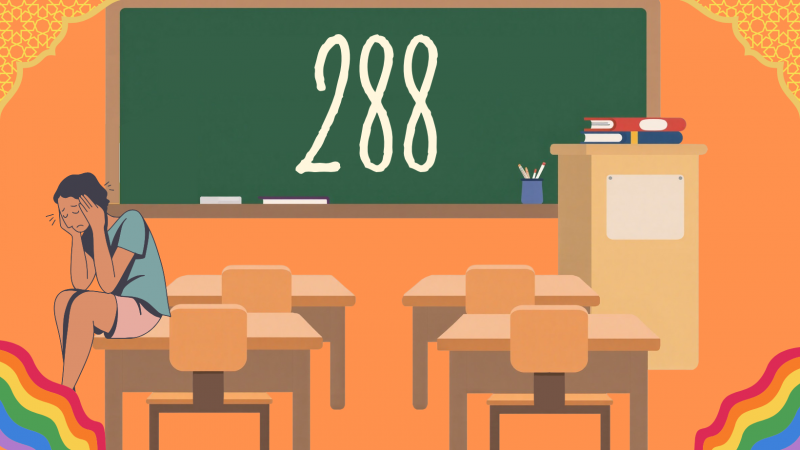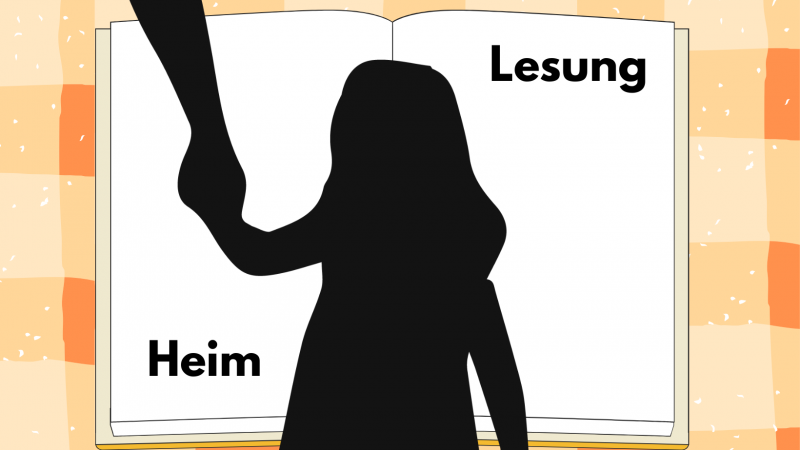Zwischen Block und Universität: „Liebe und Plattenbauten“

Foto: Jan Bosch
Paula (Anke Hoffmann) tut, was ihr gefällt. Sie schläft mit Männern, die eigentlich zu alt für sie sind, geht in Clubs und trinkt Alkohol und das alles, obwohl sie erst 16 Jahre alt ist. Allerdings scheint das niemanden wirklich zu kümmern. Ihre Mutter ist ständig auf Arbeit und sorgt zusätzlich für das Kind, das Paula mit 15 bekam.
Paul (Christian Simons) ist der Bruder von Paulas bester Freundin Mare. Er wohnt direkt gegenüber von Paula, in einer Plattenbausiedlung irgendwo in Ostdeutschland Anfang der Nullerjahre.
Die Stimmung ist gut, die Freunde gehen feiern und zelebrieren ihre Jugend in ihrem Viertel, mit ihren Leuten, während sich um sie herum alles verändert. Im Laufe des Stücks verlieben sich die beiden ineinander und Paul wird zu mehr als nur dem Bruder Paulas bester Freundin. Alle sind glücklich, bis Paula ein Studium beginnt und sich immer mehr von den Leuten aus ihrer Siedlung entfremdet.
Inspiriert ist die Geschichte von dem DDR-Film „Die Legende von Paul und Paula“. Der Original-Film spielt in Ostberlin, Anfang der Siebzigerjahre. Paula ist eine alleinerziehende Mutter, die als Kassiererin arbeitet. Sie beginnt mit dem verheirateten Paul eine Affäre, der studiert hat und eine erfolgreiche Karriere hat.
In ihrem Stück vertauscht Autorin Juliane Hendes die Rollen: Paula als Akademikerin und Paul als Arbeiter. Zudem setzt Hendes den Fokus auf Paulas sozialen Aufstieg durch Bildung. Wahrscheinlich an die Tatsache angelehnt, dass nach der Wende vor allem Frauen die neuen Chancen zum Aufstieg nutzten.
Hendes versetzt ihr Stück explizit ins Ostdeutschland der frühen 2000er und erzählt die Geschichte zweier Nachwendekinder, wie sie versuchen, sich in einem neuen Deutschland zurechtzufinden, das eigentlich nicht für sie gemacht ist.
Gestellt werden Fragen nach Identität, nach Zugehörigkeit und eigenverantwortlichem Handeln. Thematisiert wird die ostdeutsche Transformationsgesellschaft mit all ihren Krisen: Wirtschaftlicher Wandel, Arbeitslosigkeit, Abwanderung, Identität, Klassismus und Bildungsaufstieg.
Akademiker*innen, Arbeiter*innen und die Frage nach der Zugehörigkeit
In der Soziologie ist oft von einem sogenannten Habitus die Rede. Der Habitus beschreibt eine gewisse Grundhaltung, die das Denken, Handeln und die Wahrnehmung eines Menschen aufgrund seiner Sozialisierung prägt. Dieser wird durch Juliane Hendes wunderbar veranschaulicht durch den Kontrast zweier völlig unterschiedlichen Welten: dem Block und der Universität.
In der Universität wird Paula mit den Leuten nicht so richtig warm. Während ihre Kommiliton*innen bereits mit 12 Jahren hochkarätige philosophische Texte lasen, saß sie mit 12 vor dem Fernseher. Ihre Sprache wird von Mitstudierenden als derb und gewaltvoll beschrieben. Sie benutzen Wörter, die Paula erstmal nachschlagen muss. Der Habitus in der Plattenbausiedlung ist ein anderer. Hier ist das Leben von Knappheit geprägt. Paulas Vater war insgesamt 17-mal arbeitslos, die Mutter, die Paulas Kind großzieht, arbeitet so viel, dass sie im Stück kaum auftaucht. Gerade in diesem nutzenorientierten Umfeld studiert sie Germanistik. Keiner in der Siedlung versteht so richtig, was dieses Studium Paula oder ihrer Familie bringen soll. „Das löst unsere Probleme auch nicht“, kommentiert Pauls Bruder abfällig.
Mit der Zeit verstärken sich die Kontraste zwischen Paul und Paula, ebenso wie die Konflikte. Paulas altes Umfeld macht ihr immer mehr Vorwürfe. Sie werde zu schlau, zu gebildet, zu arrogant. Jetzt benutzt Paula unbeabsichtigt selbst Begriffe, die in der Siedlung niemand versteht. Sie entfremdet sich von ihrer Heimat, ohne dabei eine neue zu finden. Auch dieser Konflikt des Bildungsaufstiegs wird durch Hendes unglaublich treffend dargestellt. Paula steht zwischen den Welten, gehört nirgendwo so richtig hin und kann ihre Sorgen mit niemandem teilen.
Der Soziologe und Bildungsforscher Aladin El-Mafaalani hält Anpassungsfähigkeit und Trennungskompetenz als eine der entscheidendsten Eigenschaften für sozialen Aufstieg. „Wer aufsteigt, verändert sich selbst, seine Art zu reden und sich zu verhalten, und im Laufe der Zeit auch seinen Freundes- und Bekanntenkreis“. Die kaum zu verhindernden Brüche mit seinem früheren Leben muss man aushalten können. Viele flüchten deshalb wieder zurück, doch Paula bleibt.
Sind Probleme nur dornige Chancen?
Daran anknüpfend stellt Hendes die Frage nach der Rolle des persönlichen Entscheidungsverhaltens. Paul ist finanziell gar nicht so schlecht aufgestellt, seine Eltern sind geschieden, seine Mutter Alkoholikerin. Paul bezeichnet sein Elternhaus auch gerne als „Asi-Haushalt“. Alle Figuren sind in derselben Siedlung aufgewachsen. Manche gehen, manche bleiben. Nachdem Paula ihr Studium beginnt, verbringt Paul immer mehr Zeit mit Jungs aus der Siedlung und übernimmt mit der Zeit auch immer mehr deren Mentalität. Hendes setzt nicht nur die beiden Hauptfiguren in den Kontrast, sondern auch ihre jeweiligen sozialen Kreise und veranschaulicht, wie viel Einfluss das direkte soziale Umfeld auf das Denken und Handeln haben kann. Insgesamt lässt sie die Geschehnisse aber relativ wertfrei stehen.
Vergänglichkeit, oder auch: Zeiten ändern sich
Im Osten verändert sich alles, nichts ist noch so, wie es mal war und jeder muss sich mit den Gegebenheiten arrangieren.
In diesem Licht spielt das ganze Stück. Als Symbol fungiert dafür der Abriss von Pauls alter Schule. Die Freunde feiern dies, brechen nachts in die Schule ein, randalieren und verstehen noch gar nicht, was dieser Abriss für sie eigentlich bedeutet.
„Wir feiern unsere Jugend auf den Ruinen einer Zeit, die wir nicht mehr erlebt haben“, erklärt Paula dem Publikum.
Für die ostdeutsche Wirtschaft bleibt nach dem Systemwechsel nicht mehr viel. Nicht nur Pauls Schule wird Opfer von Rückbau und Abwanderung: Die Poliklinik und zahlreiche Geschäfte der Stadt schließen. Die Menschen verlieren ihre Arbeit, wie auch Paulas Vater. Viele wandern in den Westen ab und die Menschen, die bleiben, fühlen sich abgehängt, vergessen und nicht wertgeschätzt. Auf persönlicher Ebene veranschaulicht Hendes dieses Gefühl anhand Pauls Charakter, der sich von Paulas Aufstieg genauso abgehängt fühlt.
Die Geschichte derjenigen, die gehen und derjenigen, die bleiben
Was Juliane Hendes’ Stück so einzigartig macht, ist, dass sie das oft thematisierte Problem des sozialen Aufstiegs nicht wie üblich aus einer finanziellen Perspektive erzählt, sondern den Fokus auf die emotionalen und sozialen Aspekte dessen setzt. Die Entfremdung aus dem eigenen Milieu und der Herkunftsfamilie und den damit einhergehenden emotionalen Konflikten. Hendes bringt die Probleme des Aufstiegs auf den Punkt, veranschaulicht soziologische Theorie aufs Feinste und bettet es elegant in den Kontext der Transformationszeit der Nullerjahre ein. Sie zieht eindrucksvoll eine Parallele zwischen sozialem Aufstieg und der Nachwendezeit, da sich in beiden Fällen die gleiche Frage stellt: Gehen oder Bleiben?
Sie stellt taktvoll und dezent Fragen nach Aufstieg, Identität, Chancengleichheit und eigenverantwortlichem Handeln, ohne dabei dem Zuschauer eine Meinung aufzudrängen.
Die Inszenierung setzt auf ein minimalistisches, aber wirkungsvolles Bühnenbild. Ein paar weiße Wände, die fortlaufend umgebaut werden und so den Raum immer wieder neu definieren. Während des gesamten Stücks stehen nur die beiden Protagonisten auf der Bühne und schlüpfen in sämtliche Rollen, was die Dynamik des Stückes weiter unterstreicht.
Genauso minimalistisch und doch ausdrucksstark sind die Kostüme. Oversized-Klamotten und breite, tief sitzende Hosen verorten das Stück unverkennbar in den Anfang der 2000er. Die Schauspieler tragen ihre Outfits das gesamte Stück über, mit nur zwei Ausnahmen, die natürlich voller symbolischer Kraft stecken. In einer kurzen Szene wechseln sie in Hochzeitskleidung, während sie sich Gedanken über eine gemeinsame Zukunft machen. Besonders eindrucksvoll ist aber die rote Bluse, die Paula zu Beginn als Erzählerin trägt und am Ende, als sie an den Ausgangspunkt der Erzählung zurückkehrt, wieder anzieht – ein schönes Detail, das den Rahmen der Erzählung elegant schließt.
Insgesamt steckt das Stück voller kleiner, aber durchdachter und ausdrucksstarker Details: kleine Gesten mit der Hand, bedeutungsvolle Blicke und die Musik, die nicht nur die Atmosphäre der 2000er transportiert, sondern auch thematisch immer zur Szene passt und die Stimmung unterstreicht.
Das Stück feierte am 8. März 2025 im Großen Tasch des HLTM Premiere. Die nächsten Termine sind der 20. und 21. März. In dieser Spielzeit ist es noch bis zum 23. April zu sehen.
(Lektoriert von lurs und jub.)
studiert Psychologie und ist seit Oktober 2024 bei PHILIPP.