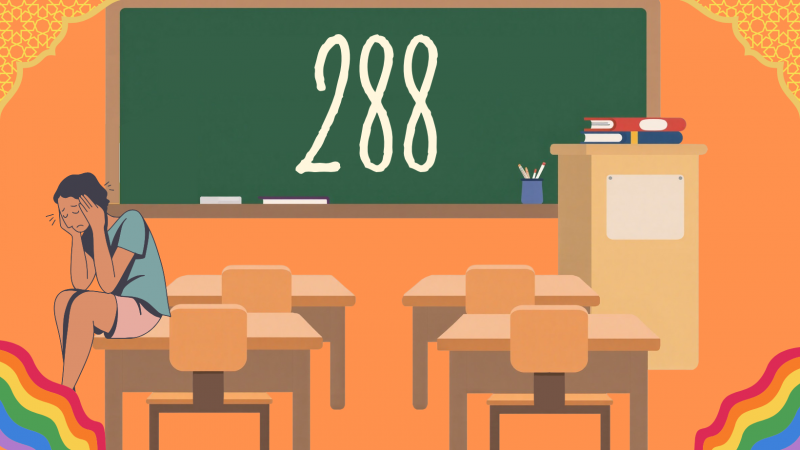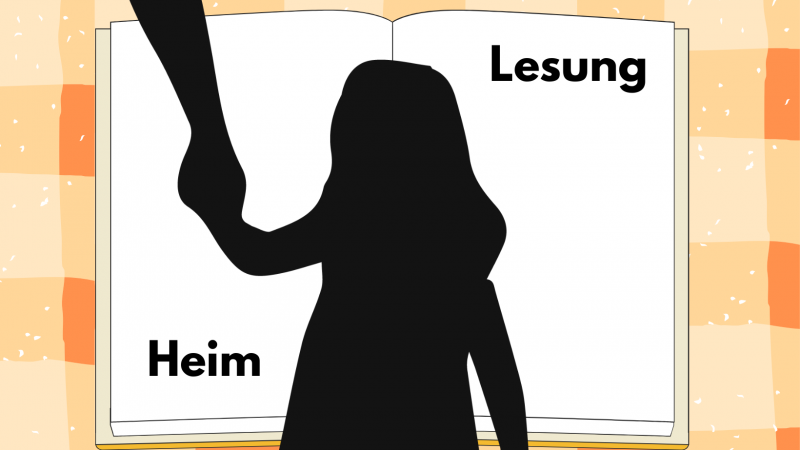Wen schützt das Gesetz? „Prima Facie“ und der Kampf gegen sexualisierte Gewalt

Foto: Jan Bosch, Collage: Laura Schiller
Was unterscheidet Recht von Gerechtigkeit? Diese Frage wird im Theatermonolog Prima Facie von der Juristin und Autorin Suzie Miller in eindrucksvoller Weise im HLTM behandelt. Im Fokus steht dabei die vielschichtige Wahrnehmung von #Metoo-Fällen – sowohl aus der Perspektive der Betroffenen als auch aus juristischer Sicht.
Das Gesetz schütz uns alle, unabhängig davon wer wir sind – mit diesem Gedanken startet Prima Facie. Daran glaubt auch die Hauptfigur, die erfolgreiche Anwältin Tessa Ensler. Diese wird gespielt von Ulrike Walthers, die die Rolle auf großartige Weise mit Leben füllt. Mit harter Arbeit und Ehrgeiz hat sie den Aufstieg aus der Unterschicht geschafft, hat sich gegen ihre eigenen Erwartungen in Cambridge durchgekämpft und gehört nun zu den besten Anwält*innen in ihrer Kanzlei. Ihre Mandanten sind in der Regel Sexualstraftäter, die sie mit hoher Erfolgsquote verteidigt. Dass sie als Frau diese Männer vertritt, nimmt sie nicht als problematischen Widerspruch war. Für sie ist das Rechtssystem ein Spiel, bei dem sie als Anwältin nur ihre Rolle spielt, damit jede*r eine faire Chance erhält. Die tragischen Geschichten der Opfer rücken so für sie oft in den Hintergrund.
Gleichzeitig grenzt sich Tessa bewusst von den Strafverteidigern ab, die die Opfer sexuellen Missbrauchs vor Gericht entwürdigend behandeln, um so einen Freispruch zu erzielen. Sie beschreibt sich als emphatische Person, die Mitgefühl mit den Opfern empfindet – ohne jedoch moralische Schuld bei sich wahr zu nehmen, wenn ihre Mandanten freigesprochen werden. Für sie sorgt das Recht automatisch für Gerechtigkeit.
Ihr Weltbild ändert sich, als Tessa selbst Opfer einer Vergewaltigung durch einen befreundeten Anwalt wird. Obwohl sie genau weiß, wie eine Verhandlung abläuft und welche Faktoren eine Verurteilung wahrscheinlicher machen, handelt sie aus Panik entgegen ihres Wissens. So begeht sie Fehler, die sie als Anwältin sonst genutzt hat, um für ihre Mandanten einen Freispruch zu erwirken, wie etwa direkt nach der Tat zu duschen und dabei die Spuren ihres Vergewaltigers abzuwaschen.
Das Stück schafft es, viele klassischen Mechanismen, die bei Missbrauch eintreten, in Tessas Geschichte einzubauen. Sie ist die Person, die durch ihre Anzeige Angst hat, ihre Karriere, für die sie jahrelang hart gearbeitet hat, zu zerstören. Sie ist die Person, die sich schämt und ihre eigene Wahrnehmung hinterfragt, während der Mann, der sie vergewaltigt hat, auf unschuldig plädiert und ihr vorwirft, sein Leben zu zerstören. Sie ist diejenige, die die Abteilung in ihrer Kanzlei wechselt, um ihren ehemaligen Freund und Vergewaltiger nicht mehr sehen zu müssen, was ihr dann später im Gerichtsprozess auch noch zum Verhängnis wird.
Das Stück, inszeniert von Angelina Zacek, beleuchtet schonungslos, dass Überlebende sexuellen Missbrauchs auch nach der eigentlichen Tat oftmals zusätzliche Torturen durch das Strafverfahren erleben und nicht die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Es zeigt eindrucksvoll, dass Rechtsprechung eben nicht immer für Gerechtigkeit sorgen kann – oder um es mit den Worten von Tessa Ensler zu sagen: „Die weibliche Erfahrung sexueller Gewalt, passt in kein von Männern geprägtes System.“ Während ich das Stück geschaut habe, musste ich sehr oft an das Zitat von Giselle Pelicot denken, dass die Scham die Seiten wechseln muss. Denn während ihr ehemaliger Anwaltskollege letztendlich freigesprochen wird, leidet Tessa nicht nur an den traumatischen Folgen der Tat, sondern hat auch ihr ganzes Leben umkrempeln müssen.
Das minimalistische Bühnenbild lenkt die Aufmerksamkeit vollständig auf die Hauptfigur. Unterstützt durch Sound- und Lichteffekte werden verschiedene Atmosphären und Szenenwechsel eindrucksvoll dargestellt, was die emotionale Wirkung verstärkt. Ich war mir am Anfang des Stücks unsicher, ob mich ein mehrstündiger Monolog fesseln könnte. Der tosende und minutenlange Applaus am Ende der Premiere zeigt, dass das Stück nicht nur bei mir Eindruck hinterlassen hat.
Besonders eindrücklich ist der Moment am Ende des Stücks, als Tessa die vierte Wand durchbricht und das Publikum direkt anspricht. Damit überträgt sie die Thematik des Stücks in die Realität: Jede dritte Frau wird in ihrem Leben Oper sexualisierter Gewalt. Prima Facie zeigt eindrücklich, dass weder Status noch Geld noch Verbindungen Frauen vor sexuellem Missbrauch und der darauffolgenden Tortur schützen. Es ist eine Anklage gegen ein Rechtssystem, das oft daran scheitert, Gerechtigkeit zu schaffen und eben nicht alle Menschen gleichermaßen schützt.
Die nächsten Aufführungen von Prima Facie sind am 21. Februar und 18. März.
(Lektoriert von lurs und leb)
Studiert im ersten Master Semester Friedens- und Konfliktforschung & ist großer ZEIT Fan und hat Bock selber bisschen Journalismus beim Philipps Magazin auszuprobieren. Ansonsten liebt sie kommentiertes Trash TV (von Mirella oder Silvi), veggie Mortadella und Fussball spielen.