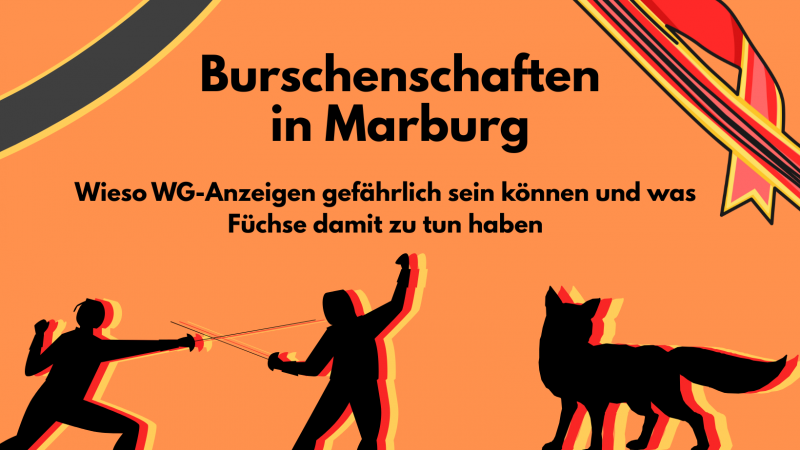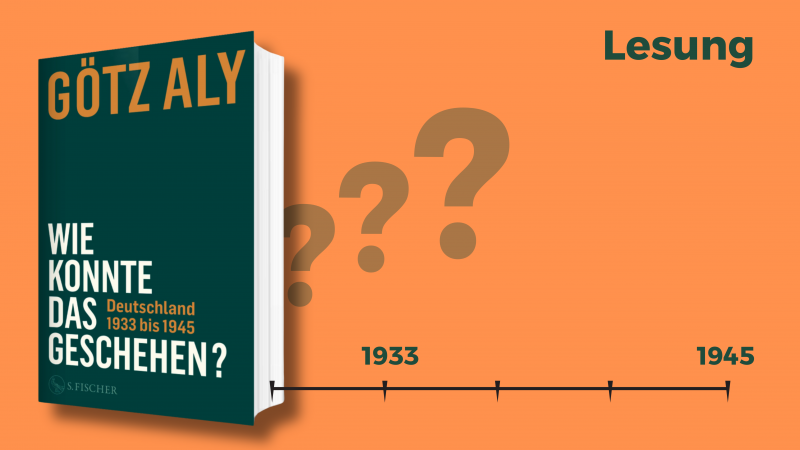„Die AfD ist nicht länger eine populistische Partei, sie ist eine Vertreiber-Partei.“

Foto: Yvo Mayr / Collage: L. Schiller
PHILIPP hat den investigativen Journalisten Jean Peters am Rande seines Vortrags über seine Recherche zum „Geheimplan gegen Deutschland“ im KFZ getroffen. Im Interview bietet er einen tiefen Einblick in seine Motivation, Methodik und seine Sicht auf aktuelle politische Entwicklungen, insbesondere in Bezug auf die AfD und den Rechtsextremismus in Deutschland.
Was hat Sie motiviert, Journalist zu werden und im gemeinnützigen Medienhaus Correctiv an investigativen Recherchen zu arbeiten?
Peters: Ich war lange Aktionskünstler und auch Kinderclown. Die Clownerie hat zwei Grundlegende Methoden: Das Spiegeln des Publikums selbst und der Aufbau einer Komplizenschaft. Als Aktionskünstler habe ich das kommunikativ fortgeführt: Mit den Mitteln der Kommunikationsguerilla und des Humors haben wir damals bestehende, häufig auch gut recherchierte Informationen veröffentlicht – aber den Absender geändert. Ein mündiges Publikum wird sich gedacht haben: Moment mal, kann das wirklich sein? Ein Konzern übernimmt hier Verantwortung für sein Treiben? Ich hatte das Gefühl, dass diese Strategie die Leute dazu bringt, eine eigene Position zu beziehen. Heute ist die Welt eine andere. Sie ist so polarisiert und voller Desinformation, dass Kommunikationsguerilla nur noch mehr zur Verwirrung beiträgt. Mit investigativer Recherche fühlt man sich da auch einfach sicherer.
Ein Jahr ist seit den Ereignissen rund um das Geheimtreffen vergangen. Was hat sich politisch seitdem entwickelt?
Zum einen die politischen Vorbereitungen eines AfD Parteiverbotsantrags im Bundestag. Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist seiner Aufgabe nachgekommen und hat die Partei mittlerweile als Verdachtsfall eingestuft. Diese Einstufung erfolgt nur, wenn es konkrete Hinweise auf demokratiefeindliche Aktivitäten gibt. Die letzte Stufe, die Einstufung als gesichert extremistisch, könnte bald folgen. Zum anderen sowohl inhaltlich als auch sprachlich hatte dies – vor der Bundestagswahl – bereits Auswirkungen auf die AfD und sie trat spürbar vorsichtiger auf.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Gerne. Maximilian Krah (MdEP) beschrieb auf X, was Parteimitglieder*innen und Rechtsextreme sagen dürfen und was nicht, solange es das demokratische System noch gäbe, sonst würden sie als Partei verboten. Das heißt, sie fangen an, ihre Sprache so zu konstruieren, dass sie nicht mehr mit dem Grundgesetz und der Demokratie in Konflikt kommen.
Was empfiehlt er denn konkret?
Krah warnt die anderen Rechtsextremen, dass man nicht mehr pauschal Ausländer rassistisch beschimpfen sollte, sondern dass es einzelfallbezogen bleiben müsse. Das finde ich schon ganz interessant, dass Neonazis sagen: Bevor du handelst und redest, überlege dir noch einmal, was die Demokratie von dir verlangt und wie du dich demokratisch verhalten sollst. Gleichzeitig bemühen sie sich, den Begriff Remigration – eine völkische Tarnbezeichnung – so zu verschleiern, dass er vor Gericht nicht mehr als grundgesetzwidrig eingestuft wird.
Weshalb, glauben Sie, blieben die Reaktionen zur AfD lange Zeit weitgehend mau, obwohl die Enthüllungen so eindeutig waren?
Dem würde ich widersprechen! Kurz nach Erscheinen der Recherche sind die Umfragewerte der AfD deutlich gefallen und das daraus entstandene zivilgesellschaftliche Engagement besteht bis heute in vielen Städten und Kommunen. Auch der Ton im Umgang mit der Partei ist schärfer geworden und das Verbot der AfD destabilisiert die ganze Partei. Die Rechtsextremen werden zwar weiterkämpfen, aber es ist nicht abzusehen, wer gewinnen wird. Auf dem Parteitag in Riesa z. B. haben sie beschlossen, den Begriff Remigration nun endgültig in das Wahlprogramm 2025 aufzunehmen. Damit sind sie nicht länger nur die rechtspopulistische Partei, sondern die Vertreiber-Partei. Und das wird auch vor Gericht relevant sein, wenn über ein Verbot der AfD beraten wird.
Der Parteivorsitzende der Linken, Jan van Aken, gab im SPIEGEL (16.01.2025) zu, 2016 TTIP-Geheimdokumente an Greenpeace weitergegeben zu haben. Er sagte: „Man darf nicht leichtfertig Regeln brechen, sondern nur, wenn es nicht anders geht.“ Würden Sie als Journalist dieser Aussage zustimmen?
Ja, ich stimme ihm zu. Ein journalistisches Beispiel für seine Aussage wäre das Mirage Tavern. Die Chicago Sun-Times deckte in den 70ern Korruption auf. Journalist*innen arbeiteten Undercover drei Monate lang als Mitarbeiter*innen in dieser Bar, um Bestechungspraktiken aufzuzeichnen. Die Enthüllungen wurden in einer Serie veröffentlicht und sorgten für Aufsehen. Obwohl die Serie für den Pulitzer-Preis nominiert wurde, kritisierte die Washington Post die Methode, da sie der Ansicht war, dass es unethisch sei, Undercover zu arbeiten. Der einzige andere Weg, Korruption aufzudecken, ist die Zwei-Quellen-Regel. Die schreibt vor, dass zwei unabhängige, anonyme Quellen eine Information bestätigen müssen, bevor sie veröffentlicht werden darf. Das war früher völlig unüblich, das reichte nicht aus! Heute hat es sich durchgesetzt. Und wenn wir eine rechtsextremistische Gruppierung haben, die sich abschottet, die unter sich bleibt und nur wohlgesinnte Journalisten*innen zu Hintergrundgesprächen einlädt, dann muss man sich neue Methoden überlegen.
Sehen Sie durch die Enthüllungen eine Veränderung im Umgang der Gesellschaft mit Rechtsextremismus?
Ja. Ob es an der Enthüllung lag, oder daran, wie sie aufgenommen wurde, darüber kann ich nicht urteilen. Es ist viel zusammengekommen, aber es war definitiv ein Momentum. Das waren vielleicht die größten Proteste gegen Rechtsextremismus, die es in Deutschland je gegeben hat. Und das hat natürlich etwas angestoßen. Was ich sehr spannend finde, ist, dass es offensichtlich auch auf den Richterbänken und in den Verfassungsschutzämtern etwas ausgelöst hat. Dieser Teil unserer Gesellschaft hinterfragt jetzt Begriffe wie „Ethnie“ und „Remigration“. Das sind Marketingbegriffe der Neo-Nationalsozialisten. Die Neonazis von heute denken sich: wir können nicht mehr in Springerstiefeln und Glatze auftreten und rechtsradikale Parolen brüllen, sondern wir müssen jetzt von Remigration reden, uns Hemden anziehen und mit Doktortitel in den Bundestag einziehen. Genau das zu entlarven, ist der aktuelle Kampf um Aufklärung, den wir führen müssen.
Gab es Reaktionen aus anderen Bereichen, mit denen Sie nicht gerechnet hätten?
Überrascht hat mich die große Resonanz des Juristenbundes und des Richterbundes, da Richter normalerweise nicht politisch Stellung beziehen. Und auch in der Wirtschaft hat sich etwas verändert. Es gibt große Unternehmensbündnisse, die gesagt haben: jetzt reicht’s, wir nutzen einen Fonds mit dem Geld, das wir bisher Parteien gaben und geben es der Zivilgesellschaft. Negativ überrascht hat mich z. B., dass Olaf Scholz und Annalena Baerbock auf Demonstrationen gegen Rechts gegangen sind, während sie selbst rechte Politik auf EU-Ebene mitgetragen haben – etwa GEAS, wo es darum ging, Kinder, die vor dem Krieg fliehen, in haftähnliche Bedingungen zu nehmen, wenn sie an der Grenze sind. Ich sage sowas selten, aber hier stellt sich die Frage, ob sie nicht lieber arbeiten sollten, anstatt zu demonstrieren.
Welche Rolle spielen junge Wähler*innen bei Bundestagswahlen, insbesondere jene, die Politik als unwichtig empfinden?
Lange hatte ich das Gefühl, dass zivilgesellschaftliches Engagement wichtiger ist als Wählen. Doch beides spielt eine entscheidende Rolle für die Demokratie. Ich empfehle, sich die politischen Prozesse anzuschauen, um zu verstehen, wie Glaubwürdigkeit in Parteien zurückgewonnen werden kann. Wir stehen am Rande eines kollabierenden Systems, da unbegrenztes Wachstum nicht möglich ist und das aktuelle System auf der Idee unendlicher Ressourcen gebaut ist. Zugleich brauchen wir neue Wege, um die Glaubwürdigkeit und die Kraft der Demokratie als menschenfreundliches System zu erhalten. Journalismus sollte Fake Politics, wie ich es nenne, widerlegen und kontrollieren. Die Wähler*innen sollten ein neues Verständnis entwickeln von Mehrparteienkoalitionen. Sonst wäre die einzige Alternative ein autoritärer Rechtsextremismus und eine isolierte Gesellschaft. Dann könnten wir nicht mehr einfach über die Grenzen fahren und hätten auch kein funktionierendes Rechtssystem mehr. Das sind alles Zustände, die es woanders auf der Welt bereits gibt.
Marburg ist bekannt für engagierte und kritische Studierende. Was würden Sie Marburger Studierenden raten, um Veränderungen anzustoßen? Welche Tipps haben Sie für kritische junge Menschen?
Da sprichst du den Aktionskünstler in mir an! Wenn Kreativität gefragt ist, empfiehlt es sich, zunächst überlegen, welche Themen einen persönlich wirklich interessieren. Und dann wird recherchiert und gebrainstormt. Es kann helfen, sich dann wieder mit anderen Dingen zu beschäftigen, auch wenn die Kernidee im Hinterkopf weiterläuft. So kann man Wege suchen, sie umzusetzen – sei es ein Poesiekreis, ein Vortrag, eine wissenschaftliche Forschungsreihe, die Beteiligung in einer Partei oder journalistische Arbeit. Wenn jemand öffentlich angegriffen werden sollte, für sein kritisches Engagement gegen Rechtsextremismus, gehört es auch dazu, zu widersprechen, zu helfen, zu diskutieren. Und klar, als Journalist sage ich: Wendet euch mit Hinweisen zu Korruption oder Rechtsextremismus an eure Lokalredaktion – am besten mit Belegen.
Zur Person:
Jean Peters ist ein deutscher Journalist, Autor und Aktionskünstler. Er wurde als Gründungsmitglied des Peng Kollektivs und der Seebrücken-Bewegung bekannt, zuletzt durch seine Recherchen bei Correctiv.
studiert derzeit Literaturvermittlung in den Medien im Master an der Philipps-Universität Marburg. Sie interessiert sich besonders für die Schnittstellen von Literatur, Medien und Gesellschaft. Und bringt ihr Wissen aus der Literaturwissenschaft in ihre journalistische Arbeit ein.