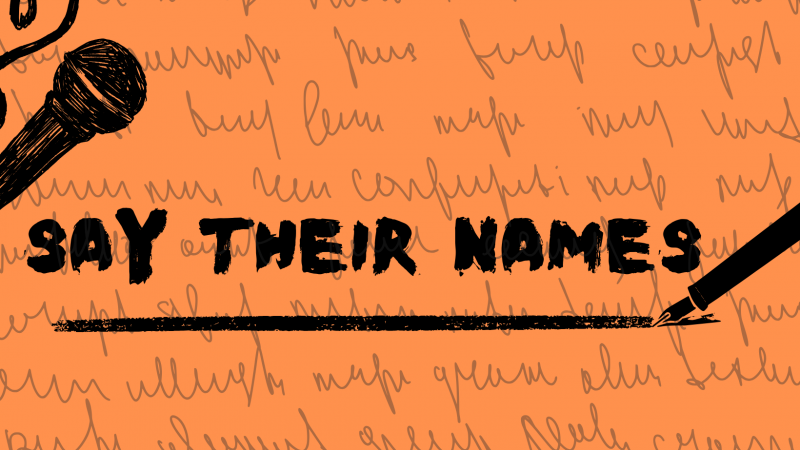Sneak-Review #256: Mit versteckter Kamera durch versteckte Zeiten

Bild: J. Kiritsis
Zeitreise-Zerwürfnisse und moralischer Minimalismus: Andrew Legge erzählt in seinem Spielfilmdebüt Lola von der Existenz und Instrumentalisierung einer ungewöhnlichen Zeitmaschine im Zweiten Weltkrieg und weiß nicht, wohin mit seiner Erfindung.
Moment. Ich glaube, ich sehe doppelt. Nach der vorherigen Sneak-Vorführung von BlackBerry folgte mit Lola ein ebenfalls im Mockumentary-Stil gedrehter Film mit formalen Spielereien, die jedoch konventionell angeordnet waren und letztendlich leider nicht viel zu sagen hatten. Nach einem Witz mit vorweggenommener Pointe kommt nun eine Pointe mit vorweggenommenem Witz. Lola ist eine Zeitreisegeschichte, die eine alternative Ereigniskette im Zweiten Weltkrieg imaginiert. Der traurige Witz dabei: Selbst mit einer Zeitmaschine hätte der Faschismus nicht effektiv bekämpft werden können.
Gefundene Anomalien
Es beginnt mit dem Start eines Films. Kurze Texteinblendungen informieren die Zuschauenden darüber, dass die folgenden Aufnahmen 1941 auf mehreren Filmrollen gefunden und restauriert wurde. Dadurch verschreibt Lola sich der Untergattung des found footage, einer Abwandlung von dokumentarisch-direkten Inszenierungsmethoden, die häufig eher dem Horror-Genre zugerechnet werden (darunter am bekanntesten: The Blairwitch Project (1999)). Die gefundenen Aufnahmen zeigen folgendes: Die Geschichte zweier, in England lebender Schwestern Martha (Stefanie Martini) und Thomasina (Emma Appleton) in den 1930er und -40er-Jahren. Es wird bereits früh klar, dass beide außergewöhnlich talentiert in unterschiedlichen Bereichen sind, Martha als Künstlerin unterschiedlicher Disziplinen, Thomasina als Wissenschaftlerin und Alkoholikerin.
Martha erfindet eine Kamera, die nicht nur Bild, sondern auch Ton aufnehmen kann. Sie ist diejenige, die die Geschehnisse des Films dokumentiert und den erzählerischen Rahmen bildet. Thomasina erfindet die titelgebende Lola, eine Maschine, die Radio- und Fernsehsignale aus der Zukunft abfangen und abspielen kann – eine Idee, die bereits dem Kurzfilm The Chronoscope (2009) des Regisseurs und Co-Drehbuchautors Andrew Legge zugrunde lag. Damit ist Lola keine Zeitmaschine im verbreiteten Sinne eines Menschen durch die Zeit befördernden Transportmittels. Sie verkehrt vielmehr in Informationen, die aus der Zukunft in die Gegenwart der Figuren geholt werden können. Nachdem die Schwestern die Maschine nutzen, um eine Stadt vor einem bevorstehenden Bombenangriff zu retten, werden sie von der Regierung bemerkt und schließlich in das Kriegsgeschehen verwickelt.
Zeitmaschinengeschichten wandern häufig auf einem Grat zwischen Science-Fiction und Magie. Wird die Maschine als mögliches Ergebnis bereits vorhandener wissenschaftlicher Erkenntnisse kontextualisiert, die weitergedacht wurden oder fungiert sie bloß als Werkzeug zur Zusammenführung unterschiedlicher Zeitebenen, deren Auswirkungen dann in der Handlung ergründet werden? Die Zeitmaschine in Lola landet irgendwo in der Mitte. Der Film interessiert sich nicht für die Entstehung und Funktionsweise dieser Maschine, sie ist schlicht da, weil Thomasina eine so brillante Wissenschaftlerin ist. Das ist zunächst in Ordnung, nicht jede Zeitmaschine muss der zentrale Gegenstand der Geschichte sein, in der sie verwendet wird. Lola leidet aber unter den unbeantworteten Implikationen, die die Kreierung einer solchen Maschine, selbst unter den spezifischen Umständen des Films, mit sich bringt.
Ein in Zeitreisefilmen häufig auftretendes und leider auch hier präsentes Problem ist dabei das der (ausbleibenden) Rekursion: Wenn die Schwestern in der Lage dazu sind, Nachrichten aus der Zukunft zu empfangen und durch ihre Beteiligung am Kriegsgeschehen selbst immer präsenter in diesen Nachrichten werden, warum empfangen sie dann keine Mitteilungen über ihre eigenen zukünftigen Aktionen? Falls ihre Vorhersagen in schlimmere Kriegstaten resultieren würden, hätten sie dann nicht Informationen über ebenjene bereits im Voraus erhalten können, um sie zu verhindern? Zeitmaschinen sind eine schwammige Angelegenheit, Zeit an sich ein noch nebulöseres Konzept. Von Lola zu erwarten, dass er all diese Komplexitäten anspricht, ist vielleicht zu viel. Ihre völlig ignorierte Anwesenheit sorgt aber dennoch dafür, dass die Handlung erzwungen und unausgereift wirkt, weil zu unklar bleibt, wieviel die Figuren wissen und was genau die Maschine für die Vorstellung von Zeit in dieser Welt bedeutet.
Das David-Bowie-Problem
Dabei ist Lola nicht völlig desinteressiert an den Auswirkungen seiner eigenen Erfindung. Eines der ersten Signale, das die Schwestern über die Maschine empfangen, ist das 1972 veröffentlichte Musikvideo zu David Bowies Lied Space Oddity. Die völlige begeisterte Martha nutzt die Maschine, um abseits des primären Handlungsstrangs mehr Musik aus der Zukunft zu erkunden und holt unter anderem die, wie sie sie charakterisiert, ‚Protestmusik‘ eines Bob Dylan in ihre Zeit. Nach einem späteren, erfolgreichen Schachzug gegen die deutschen Truppen bemerken die Schwestern, dass am Datum des Bowie-Liedes nun ein völlig anderer Künstler mit einem neuen Lied gezeigt wird. Von David Bowie lässt sich auch danach keine Spur in den Signalen mehr finden. Darüber entfaltet sich ein moralischer, wenn auch kurzweiliger Konflikt zwischen den Schwestern: Es mag sein, dass sie durch ihre Einmischung die Leben vieler tausender Menschen gerettet haben, aber dadurch veränderten sie auch die zukünftige Population so sehr, dass die Leben vieler nun anders verlaufen werden. Bowie ist dadurch vielleicht früher gestorben oder hat nie daran gedacht, Musiker zu werden.
In diesen äußerst simplen Zügen möchte Lola anscheinend einen so vielen Menschen wie möglich dienenden Utilitarismus gegen den Individualismus ausspielen. Ist ja schön, dass ganz viele Menschen gerettet wurden, aber sie werden alle zu einer namenlosen Zahl, DEN David Bowie dagegen, zu dessen Kunst ich ein ganz persönliches Verhältnis entwickeln kann, gab es nur ein Mal. Hierin steckt vielleicht ein interessanter Ansatz, in der Umsetzung fällt es jedoch schwer, ihn ernst zu nehmen: Möchte Lola wirklich, dass ich das gesamte Leben tausender Menschen gegen die Diskografie von David Bowie abwäge? Dafür kommt er zu plötzlich und wirkt fast schon naiv und kindisch inmitten der keineswegs fiktiven Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges. Eine Verwirrung, die den gesamten Film plagt: Möchte er als ernstzunehmendes Zeitreise-Drama verstanden werden oder als lose skizziertes Gedankenexperiment einer alternativen Geschichtsschreibung?
Seine anderen Eigenschaften weisen eher auf Ersteres hin. Martini und Appleton spielen die Schwestern empathisch und mit der nötigen Gravitas, um den Film zu erden, ohne dass wirklich klar wird, welchen Weg Lola gehen möchte. Lola setzt sich aus zwei unterentwickelter Hälften zusammen, die selbst in Kombination leider nicht überzeugen können. Einerseits bekanntes Kriegsdrama, inklusive einer überflüssigen Liebesbeziehung, die so peripher und unwichtig ist, dass ihre Stellung in diesem Satzgetümmel mehr Aufmerksamkeit erfordert, als sie im Film erhält, andererseits potenziell interessante Zeitreisegeschichte. Zusammengehalten werden diese Hälften nur von Legges konsequenter Inszenierung sowie der Vermischung von fiktionalem und historischem Filmmaterial, wodurch der Film seine scheinbare Authentizität erhält. Da die Kamera hier als realer Gegenstand Teil der Filmwelt ist, ist es interessant zu sehen, wie er in jeder Szene neu kontextualisiert wird, aus welchem Anlass sich Martha entscheidet, die Geschehnisse zu filmen. Auch wenn das in immer ähnliche Wackel- und Nahaufnahmen resultiert, erhält der Film so eine Unmittelbarkeit, die ihm guttut – die Präsenz einer menschlichen Hand. Es ist schade, dass er sonst so mechanisch und vorhersehbar ist.
Das Ergebnis wusste ich schon vorher: Lola wurde zu 60 % positiv und zu 40 % negativ bewertet.
ist seit Mitte Februar 2023 Redaktionsmitglied. Studiert Literaturvermittlung in den Medien. Hat den Film "Babylon" acht Mal im Kino gesehen. 25 Jahre alt. Liebt schiefe Vergleiche.