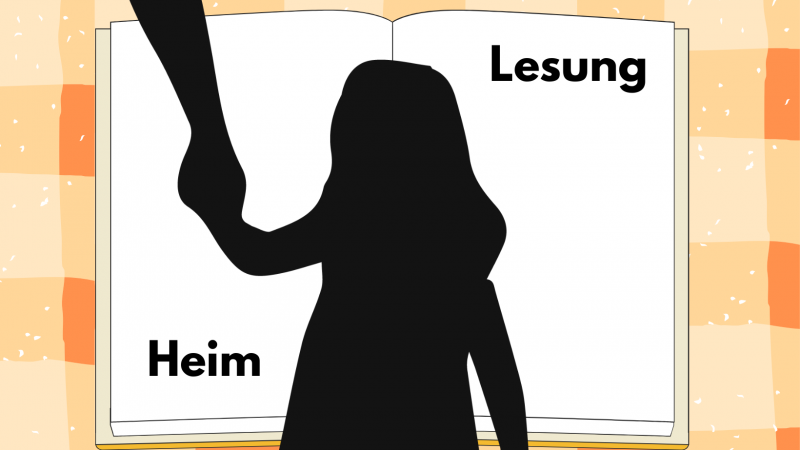Sneak-Review #237: Spoiler Alarm

Das Leben könnte so einfach sein. In kindischer Verklärung betrittst Du die Kulisse, die Du zuhause nennst, nach einem anstrengenden Tag, die Wohnung sieht seltsam zweidimensional aus, die Außenwelt wird zu einem türförmigen Ausschnitt. Die Möbel starren Dich an, sie sind zu genau beleuchtet, zu gut definiert. Ein wohlverteilter Glanz bedeckt alle Gegenstände. Die leicht kurvige Treppe hinter dem Sofa ist so sauber, dass sie eher einer Requisite gleicht. Deine Mutter ist da, die Gespräche mit ihr sind zu pointenreich, um ernsthaft als Unterhaltung durchzugehen. Du hörst das Echo von Gelächter, das jeden Witz zu unterstreichen scheint. Du weißt, was Du fühlen, wie Du reagieren musst und nichts ist kompliziert, alles ist vorgeschrieben. Fernseh-Journalist Michael (Jim Parsons) wird von seinem Chef aus seinen ‚Sitcom‘-Tagträumen gerissen. Der neue Artikel über Survivor muss schnell fertig werden. Niemand lacht. Ganz großes Fernsehen.
Seichte Realitäten
Spoiler Alarm ist ein romantisches Drama über den Umgang mit unausweichlichen Informationen. Nach einer kurzen Einführung in Michaels Berufsleben trifft er in einer Bar auf den Fotografen Kit (Ben Aldridge). Nach einer genauso kurzen Kennenlernphase, die natürlich, dem konventionellen Verlauf einer monogamen Beziehung entsprechend, gleichzeitig als Exposition für die dennoch oberflächlich bleibenden Figuren fungiert, sprintet der Film durch die ersten, grob skizzierten Stationen einer Beziehung: das immer bessere Kennenlernen, die Entdeckung gegenseitiger Merkwürdigkeiten, eine gemeinsame Routine. Spoiler Alarm hastet durch seine ersten 20 Minuten, um zu einer ganz bestimmten Stelle zu kommen: Kit wird plötzlich mit Krebs diagnostiziert. Der restliche Film besteht aus dem Umgang beider Figuren mit dieser Information. Als Vorlage dient eine reale Begebenheit, die der echte Michael Ausiello in seinem Buch Spoiler Alert: The Hero Dies verarbeitet hat. Einerseits sollte diese Begebenheit mit ihren realen Konsequenzen respektiert werden, andererseits handelt es sich hierbei nicht um jenes Ereignis, sondern um eine künstlerische Adaption, die dementsprechend separat und eigenständig bestehen können sollte.
Als solche ist Spoiler Alarm und die darin enthaltene Welt seicht und überspitzt trauerbeladen. Zu kurz ist das Beziehungsglück am Anfang, zu lang währt im Vergleich die nach der Diagnose einsetzende Trauer- und Bewältigungsphase. Natürlich entspricht das der Realität vieler, die ihr Leben durch eine solche Diagnose völlig verändert wiederfinden, aber der Film ist zur Darstellung dieser Realität viel zu nuancenlos und betont manipulativ. Er zielt in seiner Dramaturgie nur auf Reaktionen der Trauer. Die Figuren sind, trotz des überzeugenden Schauspiels aller beteiligten Akteur:innen, zu einfach konstruiert. Sie bestehen aus Ansammlungen oberflächlicher Attribute, die genauso gut einer kurzen Überprüfung eines Dating-Profils entnommen werden könnten, sie besitzen keine Persönlichkeit. Sie sind vielmehr Vermittlungsinstanzen, Gefühlsgefäße, die über die Darstellung ihrer Emotionen diese auf die Zuschauenden übertragen sollen. Es wirkt manchmal so, als würden die Figuren im Film nach jeder erneuten traurigen Wendung kurze Pausen machen, um dem Echo des weinenden Publikums lauschen zu können.
Billige Katharsis
Worin besteht der Reiz solcher ‚Krebsfilme‘? Ist es die alleinige Darstellung des Lebens mit einer Krankheit? Wird der Freiraum, den Geschichten kreieren können, zum entfernt-empathischen Ausprobieren einer todesnahen, intensiven Situation verwendet, zwecks einer temporären Erinnerung an unsere Sterblichkeit? Alles davon – und damit sind sicherlich nur die offensichtlichsten Punkte benannt – sind legitime Gründe zum Erzählen einer solchen Geschichte. Das Problem liegt eher darin, wie Spoiler Alarm diese Geschichte erzählt, nämlich erwartbar und ohne Risiko. Nach zahlreichen ähnlichen Filmen, als bekanntes Beispiel kann etwa auf Das Schicksal ist ein mieser Verräter verwiesen werden, wurden Krankheiten in zahlreichen unterschiedlichen Konstellationen erzählt. Die alleinige Wahl einer traurigen Thematik sorgt jedoch noch lange nicht für einen guten Film, wenn dieser das Thema nicht stützen kann und Spoiler Alarm bricht unter der Last zusammen. Ist dieses Zusammenbrechen aber nicht auch die Entsprechung einer denkbaren realen Reaktion? Ja, aber Spoiler Alarm möchte darunter gar nicht zerfallen, viel zu souverän-kalkuliert wirken dafür die gesetzten Trauermomente, viel zu forciert die kleinen, zur Ausbalancierung gedachten, Momente des Glücks. Wie viel ist die reinigende Wirkung, die (fiktive) Trauer haben kann, wert, wenn sie so austauschbar zu sein scheint?
Diese Identitätslosigkeit erstreckt sich auch auf die Inszenierung des Films. Regisseur Michael Showalter hat bereits 2017 mit The Big Sick gezeigt, dass er mit solchen Geschichten eigentlich umgehen kann. Auch in diesem Film wurde diente eine reale Begebenheit als Grundlage, um eine Geschichte über Liebe und Krankheit zu erzählen. In Spoiler Alarm hingegen wird keine seiner Stärken deutlich. Die Kamera schwebt funktional und behelfsmäßig durch jede Szene. Es finden sich nur Standardaufnahmen, die jede Konversation in zwei einander gegenübergestellte Einstellungen teilen. Die Inszenierung wirkt betont zurückgefahren, um der Geschichte und den Emotionen Platz zu machen, wodurch sie jedoch völliger Konventionalität verfällt. Spoiler Alarm versucht in Ansätzen, mit der Form zu spielen. Der Film überblendet Michaels traurige Realität mit seiner idealisierten Sitcom-Welt, um sowohl Rückblenden in sein bisheriges Leben zu gewähren, sie aber auch visuell als Rückzugsort zu markieren. Leider wird diese Idee nie ausgearbeitet und über oberflächliche Bezüge hinaus nur sporadisch eingesetzt. Spoiler Alarm bleibt den Mustern seines Genres verhaftet und hat über fast schon mechanisch einsetzende Tränen hinaus nichts zu bieten.
Spoiler Alarm wurde zu 90% positiv und zu 10% negativ bewertet.
ist seit Mitte Februar 2023 Redaktionsmitglied. Studiert Literaturvermittlung in den Medien. Hat den Film "Babylon" acht Mal im Kino gesehen. 25 Jahre alt. Liebt schiefe Vergleiche.