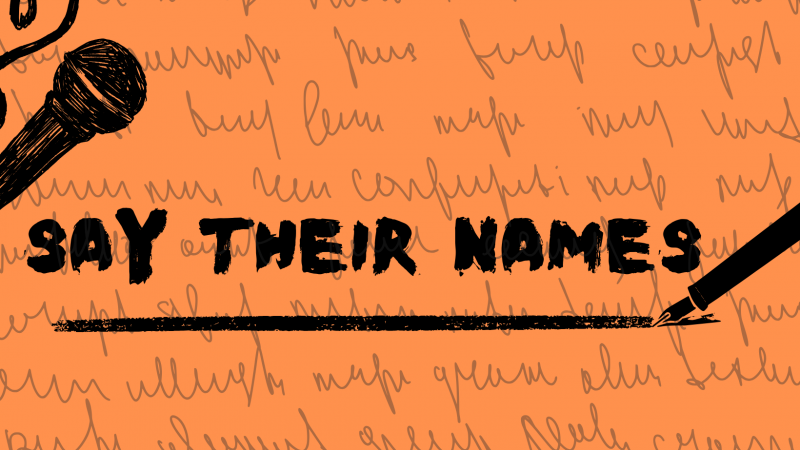Sneak-Review #253: Freelance

Bild: Malu Wolter
Alle Jahre wieder kommt sie weltweit in die Kinos, natürlich immer witzig, immer mit hochgradigen Spannungsmomenten und immer mit einem Happy End zum Dahinschmelzen. Die Rede ist von der obligatorischen Actionkomödie, der cineastischen Rückversicherung, dass die beiden Säulen des amerikanischen Egos noch stehen: der American Dream und sein Held.
In der amerikanischen Actionkomödie Freelance von Pierre Morel mimt der ehemalige Wrestler John Cena Mason Petit, einen typischen Veteranen, wie er tausendfach in amerikanischen Filmen zu finden ist. Weiß, muskelbepackt und belastet von einem gescheiterten Einsatzkommando, das außer ihm niemand überlebte. In der Ehe läuft‘s nicht, beschissener Schreibtisch-Job, kurzum: Petit ist nicht glücklich.
Dann kommt das rettende Angebot von dem befreundeten Leiter einer Sicherheitsfirma (Christian Slater): Er soll die preisgekrönte Journalistin Claire Wellington (Alison Brie) nach Paldonia begleiten, weil diese ein Interview mit dem Diktator Juan Arturo Venegas (Pablo Raba) führen soll. Derselbe Venegas war verantwortlich für den Abschuss des Kampfhubschraubers Jahre zuvor, als dessen Folge Petit den Soldatenjob an den Nagel hängte. Kaum sind die beiden in Paldonia gelandet, wird gewaltsam gegen Venegas geputscht. Auf einmal findet sich das ungleiche Trio im Dschungel wieder und muss sich gegen allerlei Gefahren behaupten.
Amerikanischer Film at its finest
Freelance wird dem Publikum als Actionkomödie verkauft, doch lustig kann diesen Film nur finden, wer ausgelutschte Witze mag. Ob Masons Nachname extra so ausgewählt wurde, damit Venegas zu dem Bodyguard in einem intimen Moment nach der Dusche sagen kann, dass „er“ gar nicht so petit ist? Geht die Gag-Quote auch gegen null, ist dem Drehbuchautor beim Schreiben zumindest eines gelungen: Möglichst viele Klischees mit möglichst wenig Reflektion zu kombinieren.
Mit nur wenigen Stellschrauben hätte Freelance bereits die erste Ebene dieses Kritikpunktes umgehen können, bevor die Lichter im Saal überhaupt ausgehen. Es ist keine neue Kritik, die aber trotzdem nicht alt wird, wie hier wunderbar exemplarisch gezeigt werden kann: Mal wieder ist der Held weiß und männlich, dabei hätte der Film keine Not gelitten, wäre die Figur Mason Petit komplett aus dem Drehbuch gestrichen worden. Ganz im Gegenteil, dem Publikum wäre die unerträgliche Saga des amerikanischen Heldentums erspart geblieben, die mit Männern nun mal so viel besser funktioniert als mit Frauen. Dann wäre Freelance die Actionkomödie, der dumpfe Blödelfilm zum Abschalten, als der er wahrscheinlich gedacht war, doch noch unterschwellig politisch.
Schließlich deutet alles, die Namen, die Hautfarbe und die Umgebung im fiktiven Paldonia darauf hin, dass die Vorlage im südamerikanischen Raum liegt. Das ist ja auch erstmal gar nicht so weit hergeholt. Immerhin war Südamerika vor allem im vergangenen Jahrhundert noch mehrheitlich diktatorisch regiert, was sich heute größtenteils gewandelt hat. So weit, so gut. Was aber auch zur Wahrheit dazu gehört, wenn es um autokratische Regime in Südamerika geht: In 21 Staaten haben die USA durch Intrigen und militärische Interventionen Putsche mitorganisiert, wenn nicht sogar in Gang gesetzt, um kapitalismusfreundlichen Regierungen den Weg zur Macht zu ebnen. Die Folge waren zahlreiche Diktaturen, deren Auswirkungen bis heute spürbar sind. Vor diesem Hintergrund erscheint es besonders zynisch, dass der Erlöser ausgerechnet im Korpus des ‚starken Amerikaners‘ in Erscheinung tritt.
Die armen Untertanen
Die Missgunst der Bevölkerung Paldonias kurz vor dem Putsch ist spürbar, als sich der Konvoi aus SUVs mit den Leibwächtern, Militärs und unseren drei Protagonist*innen auf der Fahrt zum Regierungssitz in einem Städtchen durch die Menschenmassen schiebt. Venegas, überzeugt vom Rückhalt seiner Untertanen, strahlt und winkt durch das Fenster. Einige Militärs drängen die Menschen mit Maschinengewehren zurück, was ihnen mehr oder weniger gelingt. In einem Moment des Wartens geraten einige junge Schulmädchen in das Blickfeld des Diktators. Sein heuchlerisch freundliches Lächeln erwidern sie mit hasserfülltem Blick und erhobenem Mittelfinger. Venegas hört auf zu lächeln. Die Militärs schieben die Mädchen ein wenig zurück. Mehr passiert nicht. Es ist schon unglaubwürdig genug, dass Kinder in einer Diktatur ihrem gewaltverliebten Herrscher so unverblümt ihre Haltung zeigen, aber die Reaktion der Exekutive ist noch lachhafter. Eine wirkliche Rolle spielt die Bevölkerung in dem Film aber eigentlich nicht, außer das Hauptrollen-Trio braucht ein ihnen blind verfallenes Publikum. Wie zum Beispiel als die drei es auf der Flucht vor Scharfschütz*innen, Rebell*innen und Kampfhubschraubern ins Heimatdorf Venegas‘ geschafft haben und mit offenen Armen empfangen werden. Von Missgunst kann keine Rede mehr sein.
Nun kann die preisgekürte Wellington endlich ihr exklusives Interview mit dem Diktator führen. Petit streamt live mit. Venegas nutzt die ihm dargebotene Bühne, um auf Wellingtons Fragen pathetische Antworten zu geben, die am Ende des 5-Minuten-Gesprächs in eine nichtssagende Rede ausufern. Tosender Applaus seitens des Dorfes, das sich die Wahlkampagne – und jede andere Bezeichnung wäre ein Euphemismus – nicht entgehen lassen will. Qualitätsjournalismus. Aber dazu kommen wir später noch. Auf der weiteren Flucht vor den Rebell*innen gerät Wellington in ihre Hände, die sie nun folglich gegen Venegas austauschen wollen. Am verabredeten Treffpunkt treffen die Geiselnehmer auf Petit, auf einmal brennt es, dann wird geschossen, und schließlich kommt Venegas in Slow Motion um die Ecke. Hinter ihm: Die Stadtbevölkerung, glühend vor Eifer, den Mann zu verteidigen, der sie sonst mit so harter Hand regiert.
Der nette Diktator
Im Büro der Sicherheitsfirma sieht Petit auf dem Fernseher Venegas, wie er gerade offensichtlich bei einer Ansprache mit einem Maschinengewehr in die Luft feuert. Ein Mann, der Macht und Waffen liebt, wie so viele reale Diktatoren es auch tun. Umso überraschender, dass Venegas sich den restlichen Film überhaupt nicht mehr dem Narrativ entsprechend verhält. Am Flughafen begrüßt er Wellington mit Handkuss, umgarnt sie und schleimt, was das Zeug hält. Im Auto geht das so weiter, bis der Putsch sie unterbricht. Es wird nicht ersichtlich, warum ihm etwas an Wellingtons Meinung liegen sollte. Die einzige Erklärung wäre, dass er sich einen positiven und wohlwollenden Artikel von ihr erhofft. Doch auch den Grund dafür liefert der Film nicht.
Was Venegas Authentizität aber vor dem Hintergrund seiner Selbstdarstellung als berühmt-berüchtigter Tyrann am meisten untergräbt und ihn bemitleidens- und verachtungswürdig zugleich macht, ist sein Verhalten, wenn es ernst wird. Wenn die Waffen sprechen, ist der masochistische Diktator, dem sonst vor Selbstgeilheit fast die Hose platzt, leise und zieht den Schwanz ein. Nur einmal greift er selbst zur Waffe, um hinterrücks einen Rebellen zu erschießen. Falls das Ziel dieses verwirrenden Charakters sein sollte, die verschiedenen Facetten Venegas Persönlichkeit abzubilden, ist das nicht gelungen. Seine Rolle wirkt, als wäre sie aus den Schnipseln verschiedener anderer Figuren zusammengesetzt worden, die aber nicht zueinander passen. Eine Mischung aus masochistischem Tyrann, schleimigem Casanova und unlustigem, redseligem Nichtsnutz.
Die allgegenwärtigen Medien
Und der hochdotierte und renommierte Journalistenpreis geht an… Claire Wellington. Damit ist die Messlatte gesetzt und sie wird auch kein einziges Mal verfehlt bis Wellington in Paldonia, die Coolness in Person, aus dem Flugzeug steigt, zielstrebig und professionell lächelnd auf Venegas zugeht, ihm die Hand hinhält – und die Kontrolle über die Situation verliert, als dieser ihr einen Kuss auf die Finger drückt und im Anschluss ein für Wellington unvorteilhaftes Selfie macht.
Venegas treibt auch während der darauffolgenden Autofahrt weiter sein schmieriges Spiel und schafft es, die preisgekürte Journalistin zum Schmelzen und alle anderen zum Fremdschämen zu bringen. Doch das Objekt ihrer Begierde ist nicht der Machthaber, sondern ihr Bodyguard, den sie in einem intimen Augenblick mehrmals peinlich anmacht und ins Bett zu kriegen versucht. Vergeblich. Fremdschämmoment Nr. 3 ist das bereits beschriebene Interview mit dem Diktator, aber als sie während des großen Shutdowns, bei dem sämtliche Parteien versuchen, mit möglichst viel Tamtam die Gegenseite abzuschlachten, live streamt, geht meine Achtung vor ihr vollends flöten. Ich versuche es als Kritik an der amerikanischen Sensationsgeilheit und 24/7-live-Berichterstattung zu sehen, aber dafür ist die Szene nicht überzeichnet genug. Dieser Livestream hat keinen höheren Zweck, er bildet einfach einen Aspekt der Art und Weise ab, wie in Amerika Berichterstattung stattfindet und das ist durchaus ein kritikwürdiger Punkt (der übrigens zum Beispiel im Film Nightcrawler – Jede Nacht hat ihren Preis (2014) weitaus besser in den Fokus gestellt wird).
Dein Freund und Helfer, das Maschinengewehr
Fällt die Waffenbilanz in den ersten eineinhalb Stunden für amerikanische Verhältnisse noch recht moderat aus, nimmt sie in der letzten halben Stunde exorbitante Ausmaße an. Obwohl vermutlich das Gegenteil erreicht werden sollte, langweilt mich die übermäßige Maschinengewehrpräsenz. Endlich kann John Cena glänzen, beim Halten der AK47 seine Muskeln zeigen und wild in der Gegend rumballern. Freelance wäre definitiv ein besserer Film geworden, hätte es so viele Waffen wie Gags und so viele Gags wie Waffen gegeben.
Die fehlende Reflektion der Protagonist*innen vervollständigt das von Unglaubwürdigkeit und alberner Lächerlichkeit gezeichnete Bild von Freelance. Es gibt im gesamten Film keinen einzigen Learning Moment und auch keine Selbstzweifel, zu denen alle ihre Berechtigung gehabt hätten. Venegas, weil er ein rücksichtsloser Tyrann ist, Drehbuchautor Jacob Lentz und Regisseur Pierre Morel, weil sie ihn eben genau so nicht darstellen, sondern im Gegenteil, fast schon als witzig und cool glorifizieren. Wellington, weil sie, trotz ihres Renommées, im falschen Moment mit der Kamera auf das Geschehen draufhält, als Worte noch vollkommen ausgereicht hätten. Plumpe Methodik auf BILD-Niveau, um den Voyeurismus der amerikanischen Gesellschaft mit Bildern zu füttern, die das Narrativ der ‚unterentwickelten und bedauernswerten Dritten Welt‘ verstärken, in der sich alle die ganze Zeit nur abschlachten. Und natürlich Petit, der, ohne auf seine Familie Rücksicht zu nehmen, einfach mal beschließt, auf eine lebensgefährliche Mission zu gehen, weil er in einer Ehekrise steckt. Spannend war bis zum Abspann einzig und allein die Frage, wann der Moment kommt, in dem die drei Hauptfiguren innehalten und sich fragen: Wie bescheuert war mein Verhalten in letzter Zeit eigentlich?
Weniger Klischees, mehr Reflexion bitte
Freelance ist eine unfassbar schlechte Actionkomödie und auch eine unfassbar schlechte Satire. Letztere wollte er auch nicht sein, aber er hätte ein guter, vergnüglicher Film sein können, wäre er zum Beispiel im Stil von Das Leben des Brian gedreht worden. Ich möchte nicht falsch verstanden werden: Der Film dreht mir nicht wegen der durchschaubaren Handlung und des schlechten Drehbuchs den Magen um. Inhaltslose Geschichten und nichtssagende Dialoge, die durch pointenlose Witze begeistern wollen, dürfen von mir aus existieren. Aber wenn sie schon nichts großartig Geistreiches beizutragen haben, sollten sie bitte auch keinen weiteren Schaden anrichten. Stumpfer Blödsinn muss doch auch ohne die Aufrechterhaltung längst entlarvter und nervtötender Klischees möglich sein. Das ist Jacob Lentz mit seinem Drehbuch-Debüt leider nicht gelungen.
Freelance ist ein enttäuschender Film, dem es an der Reflektion mangelt, die nötig gewesen wäre, um eine Entwicklung der Charaktere voranzutreiben. Weiter mutet Freelance wie ein Porno der besonderen Sorte für das republikanisch-amerikanische Ego an: Seht her, wir haben abgehalfterte Mittvierziger, die im Alleingang ein armes, unterdrücktes, hilfloses, mit Kulleraugen zum großen Bruder Amerika aufsehendes Drittweltland retten können und am Ende wird auch noch alles gut werden.
Ist er nicht fantastisch, dieser American Dream, den es aber verdammt nochmal nicht gibt, und den wir endlich aufhören sollten zu reproduzieren?!
Durchwachsene Bilanz: Freelance wurde vom Sneak-Publikum zu 55 Prozent positiv und zu 45 Prozent negativ bewertet.
Stolze Stuttgarterin, 23 Jahre jung, studiert Nah- und Mitteloststudien. Seit März 2022 dabei und bildet seit Januar 2023 mit Leo die Chefredaktion. Mit dem Körper in Marburg, dem Geist in Palästina und dem Herzen in den Alpen.