100 Jahre tot und doch unsterblich: Kafka in Scherben, Kafka als Liebhaber
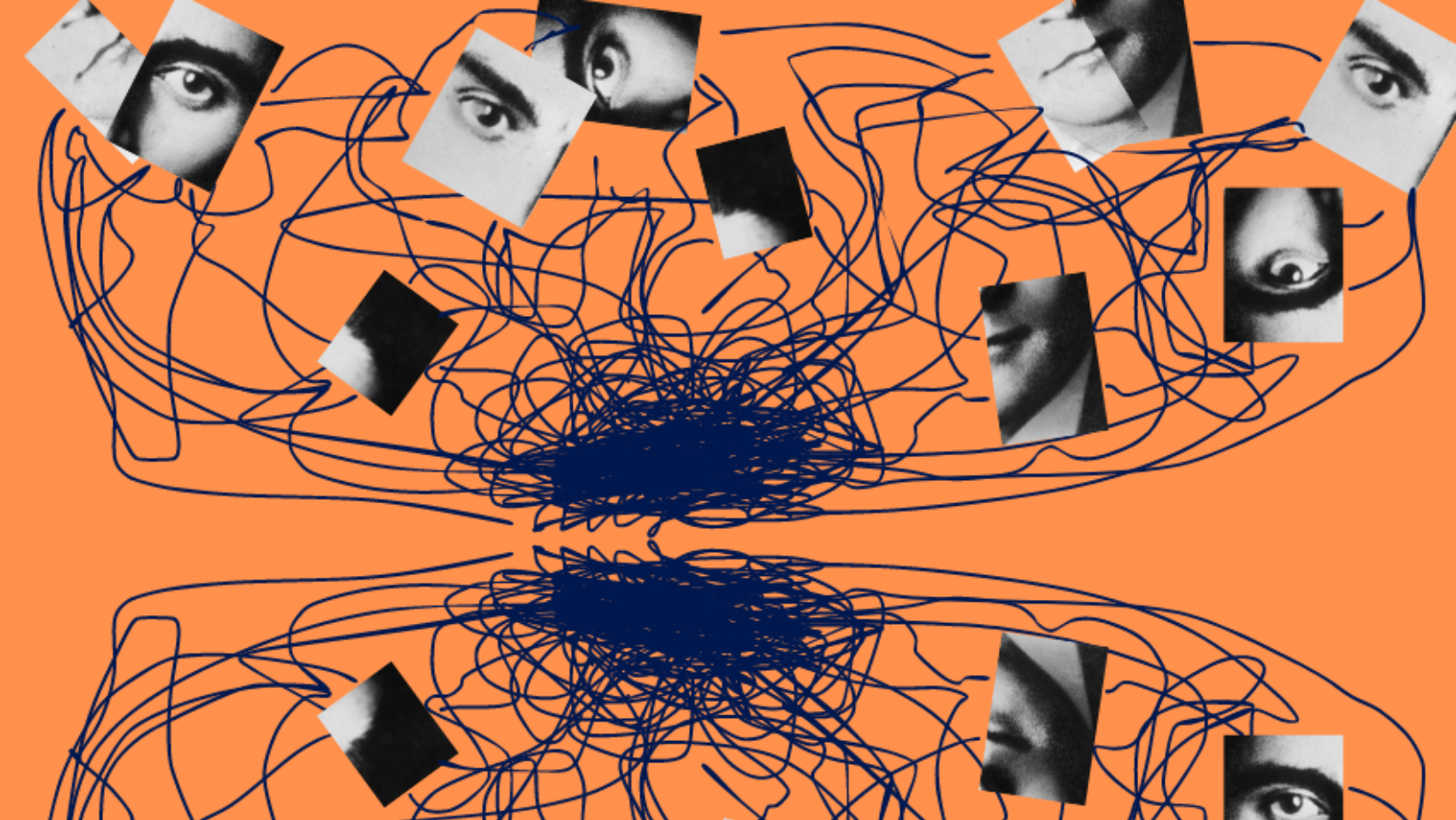
Foto: Archiv Klaus Wagenbach
Franz Kafka gilt inzwischen als Monument gewordene Person einer als schwierig und unergründlich angesehenen Literatur. Vor 100 Jahren ist er gestorben. Zu diesem Anlass wurden unter anderem eine Serie und ein Film produziert, die sich beide mit Kafka auseinandersetzen. Wie gehen sie dabei vor und gelingt es ihnen dem Mythos etwas Neues abzugewinnen?
Der Unfallversicherungsangestellte und Schriftsteller Franz Kafka erlag am 3. Juni 1924 im Alter von 40 Jahren den Komplikationen einer Kehlkopftuberkulose. Vor seinem Tod entlockte er, ganz klassisch auf seinem Sterbebett, seinem besten Freund und seiner Zeit viel bekannteren Schriftstellerkollegen Max Brod das Versprechen, all seine Hefte voller Textskizzen und Romanfragmente zu verbrennen. Brod entschied sich angesichts der von ihm eingeschätzten Qualität dieser Texte dagegen und seitdem können und wollen wir Kafka nicht mehr in Ruhe lassen.
So versammeln sich auch in diesem Jahr, dem hundertsten nach Kafkas Tod, viele Literaturinteressierte auf einer gedanklichen Gedenkfeier, um weitere Lorbeeren auf einen Sarg zu werfen, in dem sich die vorbeiziehenden Gesichter gestreckt reflektieren. Natürlich geht es dabei nicht wirklich um Kafka und seine Texte, sondern vielmehr um eine Re-Evaluation der gesellschaftlichen Bedeutung, die beide Konstrukte für uns haben. So sammeln sich in den Feuilletons fleißig Beiträge über die anhaltende, ja nie nachgelassene Bedeutung Kafkas für unsere Zeit. Es wird nach neuen Aspekten gesucht, die man in seinen dunklen (natürlich!), rätselhaften (selbstverständlich!) Texten beleuchten kann, in denen nutzlose Kreaturen ziellos durch ihr Leben stolpern oder stagnieren (die ganze heutige Welt schon damals!); ein Interpretationsfest.
Als womögliche Hauptattraktion des Festes: die neue, von der ARD ko-produzierte Mini-Serie Kafka. Unter der Regie von David Schalko und den auch von Schalko mitgeschriebenen Drehbüchern des zugänglichsten und seichtesten Experimentalisten der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur Daniel Kehlmann, wählt die sechsteilige Serie einen multiperspektivischen Ansatz. Die Grundlage bietet dabei die umfangreiche, dreibändige Biografie des Kafka-Konsuls Rainer Stach.
Jede Folge zentriert eine andere wichtige Figur aus Kafkas Umfeld, über die je eine neue Facette Kafkas hervorgehoben wird, wobei diese Struktur durch eine Folge über seine Familie, allen voran das Verhältnis zu seinem Vater (oho!), und eine Folge über sein Berufsleben aufgelockert wird. Daneben finden sich Folgen über drei wichtige Liebesbeziehungen und schon haben wir es mit entfernt aussagekräftigen Fragmenten eines Lebens zu tun.
Fragmentarisch sind sie dabei in mehrerlei Hinsicht: Sie enthalten zusätzlich zu den Annäherungen an Kafka über die anderen Figuren auch Splitteradaptionen seiner berühmtesten Texte, die dadurch eng mit seinem Leben verbunden werden. Die familiären Pflichten, in die sich Kafka unentwirrbar verstrickt, werden die Grundlage für die Zimmerexistenz des Gregor Samsa aus Die Verwandlung, der verschneite Kurort, den er in der letzten Folge besucht, ist in der Serie die Vorlage für das gleichsam zugeschneite Dorf aus Das Schloss. Die Serie möchte so die Entstehungsbedingungen der Texte durch Bezüge zur Biografie, wohl oder übel, erklären und verfolgt dadurch drei Ziele: Sie möchte dramatisierte Lebensgeschichte, exemplarische Textadaption und eigenständiges ästhetisches Kunstwerk zugleich sein.
Gebrochene Ehrfurcht
Das alles ist aber doch immer noch die tiefe Verbeugung vor einem Genie, oder? Ein Nachspüren über ihm nahestehende Figuren, weil sich niemand anmaßen würde, den großen Kafka direkt zu erfinden? Letztendlich bleiben so ziemlich alle anderen Figuren doch Nebenfiguren, unterschiedliche Objektive, die auf das gleiche Motiv gerichtet sind? Ja, aber damit geht Kafka offen um. Das gelingt der Serie unter anderem durch eine durchwegs präsente, ironische Distanzierung von einem ehrfürchtigen Lobes-Ton durch die Nutzung einer fehlbaren Erzählerstimme, die von den dann direkt in die Kamera sprechenden Figuren stets korrigiert wird.
Dieses stark an andere Kehlmann-Texte erinnernde Element rahmt denn auch die gesamte Serie, da jede Folge als ein Neuansetzen der Stimme, ein Wiederaufgreifen der Geschichte aus einem anderen Sichtpunkt, dargestellt wird und sie so vor allzu autoritativen Aussprüchen schützt; nichts, was mit Kafka in Berührung kommt, darf ja vollends klar sein und jede Form von angenommener Autorität ist in sich absurd (anscheinend!). Doch die Ehrfurcht vor ihrer titelgebenden Figur sitzt der Serie dennoch in den Knochen. Als Authentizitätsmerkmal getarnt, ist so ziemlich jeder von Kafka gesprochene, längere Satz ein Zitat aus seinen Tagebüchern und Briefen, jede Äußerung bereits ein Stück kanonisierte Literatur, weil sich solche Sätze selbstverständlich niemand sonst hätte ausdenken können („Ein Käfig ging einen Vogel suchen?“ Geh bitte).
Aber wer ist das denn nun, dieser Kafka, an den sich die Serie heranwagen möchte? Kafka (Joel Basman) ist ein guter Unfallversicherungsangestellter, der am besten abends schreiben kann und sich sonst damit quält, nicht schreiben zu können. Alle seine Klamotten sind ihm scheinbar eine Nummer zu groß, seine Arme hängen oft bewegungslos an seinen Seiten herunter wie zu kurze Krückstöcke. Seine Stimme ist merkwürdigerweise gleichzeitig hoch und tief, das Gesicht wird häufig nur von Kleinstbewegungen durchzogen. Er hat Schwierigkeiten damit, sich gegen andere durchzusetzen. Sein (spärlich eingesetztes) Lachen klingt wie ein alkoholisierter Goofy und er kaut jeden Bissen seines Essens 40-mal, um, wie er selbst erklärt, so schon seine Verdauung anzuregen.
Basman kann all diese Merkmale, ob schrullig oder unnahbar, in seinem Spiel kohärent zusammenbringen, ohne dass er zu einer Karikatur wird, da es ihm gelingt, die lächerlichen Aspekte seiner Figur ernst zu nehmen und über die ernsten zu lachen. Sein Kafka wird dank der überzeugend gezeichneten und gespielten inneren Konflikte zwar zu einer nachvollzieh-, aber dennoch nie vollends erschließbaren Figur. Genauso werden die von ihr gesprochenen Tagebuchsätze und Briefe in ihrer Wirkung nicht restlos erklärt, sondern lediglich in einen Kontext gesetzt. Wie Kafka von seinen Freunden und Partnerinnen, werden sie in Lebensumstände eingebettet, die sie konsumierbarer machen. Dieser Kafka steht also erfolgreich für sich, aber stets brav auf den Stelzen der bekannten Texte und der Biografie von Rainer Stach.
Wer hat Angst vor leisen Liebesfilmen?
Den Versuch, sich von Hilfsmitteln dieser Art zu lösen und einen Kafka aus größerer Distanz zu zeichnen unternimmt Die Herrlichkeit des Lebens. Die Filmadaption des gleichnamigen Romans von Michael Kumpfmüller über die letzten Lebensjahre Kafkas wird erzählt als Liebesgeschichte mit Dora Diamant (Henriette Confurius), die Kafka (Sabin Tambrea) auf einem Kuraufenthalt kennenlernt. Tambreas Kafka fügt sich nahtlos, fast schon zu gut, in die Ästhetik und das Erzähltempo des unter der Regie von Georg Maas und Judith Kaufmann entstandenen Filmes ein: leise, unaufgeregt und bereits leblos noch bevor sein eigentlicher Tod einsetzen konnte. Tambrea spielt ihn als feinfühligen Märchenerzähler, der Kindern am Strand Geschichten vorträgt. Dieser zunächst interessante, da von bisherigen Vorstellungen abweichende Ansatz bleibt aber unausgereift, weil es dem Film überhaupt nicht um diese Momente geht (wir sehen zum Beispiel nie, wie die Kinder auf den tristen Inhalt von seiner kleinen Fabel reagieren), sondern um die Liebesbeziehung der beiden Figuren.
Eine verständliche Fokusverschiebung, doch diese Beziehung schafft es nie, über die gewöhnlichen Gesten eines Liebesfilms hinaus eigene Akzente zu setzen. Trotz der Stärken der beiden Hauptdarsteller*innen – Tambreas’ leises Selbstbewusstsein, Confurius’ Nahbarkeit – bleibt alles merkwürdig starr und pappig.
Jegliche Nuancen der Figuren gehen in der eintönigen Inszenierung unter, die sehr darauf bedacht ist, möglichst zart und unaufdringlich zu bleiben, sich in immergleichen halbnahen Einstellungen zu erzählen. Dadurch kommt nie ein Gefühl für die Beziehung zwischen Kafka und Dora auf, weil die repetitive Inszenierung noch von genauso klischeebeladenen Liebesfilmmomenten komplettiert wird. Kafka geht mit Dora barfuß am Strand spazieren, die Wellen umspülen ihre Füße; sie liegen im Bett nebeneinander und schauen sich einfach an; sie sitzen nackt, aber zugedeckt, auf dem Sofa und Dora liest Kafkas Texte. Natürlich reden sie nur in sanften Flüstertönen miteinander. Diese Momente können im Einzelnen nicht wirken, weil die Figuren dafür zu vage bleiben, fügen sich aber auch in kein überzeugendes Gesamtkonstrukt ein, weil sie dafür zu bekannt sind. Die Herrlichkeit des Lebens versucht einen emotional-liebevollen Kafka kurz vor seinem Tod zum Leben zu erwecken, reanimiert dadurch aber nur eine aus geliehenen Körperteilen zusammengenähte Kitschfigur.
Unbeholfene Grabrede
Dass unser gesellschaftlich imaginierter Kafka beide Zugänge, die zersplitterte Figur und den stillen Liebhaber, aushält, zeugt von seiner Wandelbarkeit und der Anziehung, die seine Texte immer noch auf einige ausüben. Dass mir ein Zugang besser gefällt als der andere, zeugt wiederum nur von meinem persönlichen Kafka-Bild, das sich unvermeidbar als Vergleichsfolie zwischen jede Darstellung dieser Figur schiebt und sich aus den Aspekten zusammensetzt, die mir an seinen Texten am besten gefallen. Ein Abgleich mit den Versionen anderer Menschen kann nur auf das Festhalten von Unterschieden und Gemeinsamkeiten hinauslaufen, die sich, besonders bei so anerkannten und weitbekannten Personen wie Kafka, längst nur noch mit indirekten Nebenbemerkungen zu den eigentlichen Texten zufriedengeben. Es wird der Umweg über das Leben der Person gewählt, ausgewählte biografische Konstruktionen zur Erschließung der unnachgiebigen Texte konstruiert; Beiwerk um Beiwerk wird auf sie geschaufelt. Letztendlich laden sich alle selbst zu dieser Trauerfeier ein und verlassen sie entweder mit einer neuen Kerbe in ihrem Kafka-Bild oder einem mulmigen, nichtsnutzigen Gefühl im Bauch.
ist seit Mitte Februar 2023 Redaktionsmitglied. Studiert Literaturvermittlung in den Medien. Hat den Film "Babylon" acht Mal im Kino gesehen. 25 Jahre alt. Liebt schiefe Vergleiche.


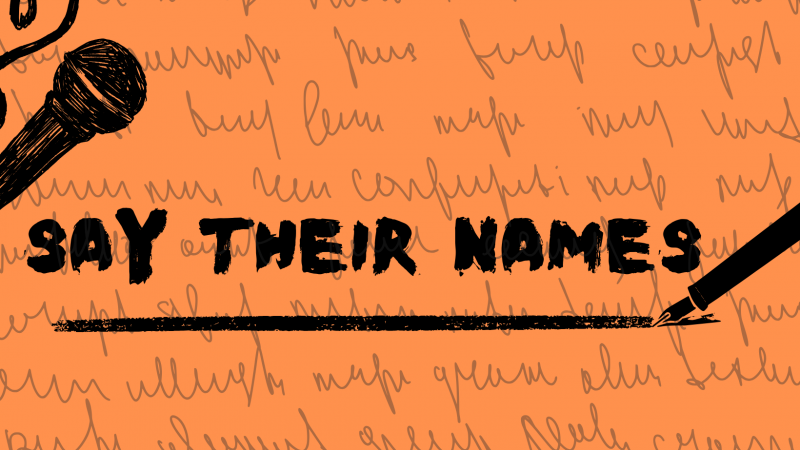




Ein Gedanke zu „100 Jahre tot und doch unsterblich: Kafka in Scherben, Kafka als Liebhaber“